Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Other cookies are configurable.
Mariupol
„Als wir die ukrainischen Aufnäher mit den Dienstgradbezeichnungen an den Uniformen der Soldaten erblickten, weinten wir wie Kinder“
Marina Pilezkaja, Kesselwärterin im Stahlwerk „Asowstahl“

Marina Pilezkaja mit ihrem Ehemann
Foto mit freundlicher Genehmigung von Marina Pilezkaja
Foto mit freundlicher Genehmigung von Marina Pilezkaja
Wir hatten gültige Visa für einen dauerhaften Aufenthalt in Israel und sogar Tickets für den 15. März. Aber wir haben es nicht geschafft… Mir war bewusst, dass der Krieg unausweichlich war, doch trotzdem hoffte ich auf das Beste. Am 24. wurden wir um halb fünf morgens von einer Explosion wach. Mein Mann fragt: „Krieg?“ „Ja“, antworte ich, „Krieg.“
Ich ging trotzdem zur Arbeit, aber nach einigen Stunden begann starker Beschuss – da wurde die Förderung eingestellt (das ist ein Notfall – die Öfen können nicht wieder in Betrieb genommen werden) und Ruslan (mein Mann) kam mich an der Pforte abholen.
Ich ging trotzdem zur Arbeit, aber nach einigen Stunden begann starker Beschuss – da wurde die Förderung eingestellt (das ist ein Notfall – die Öfen können nicht wieder in Betrieb genommen werden) und Ruslan (mein Mann) kam mich an der Pforte abholen.
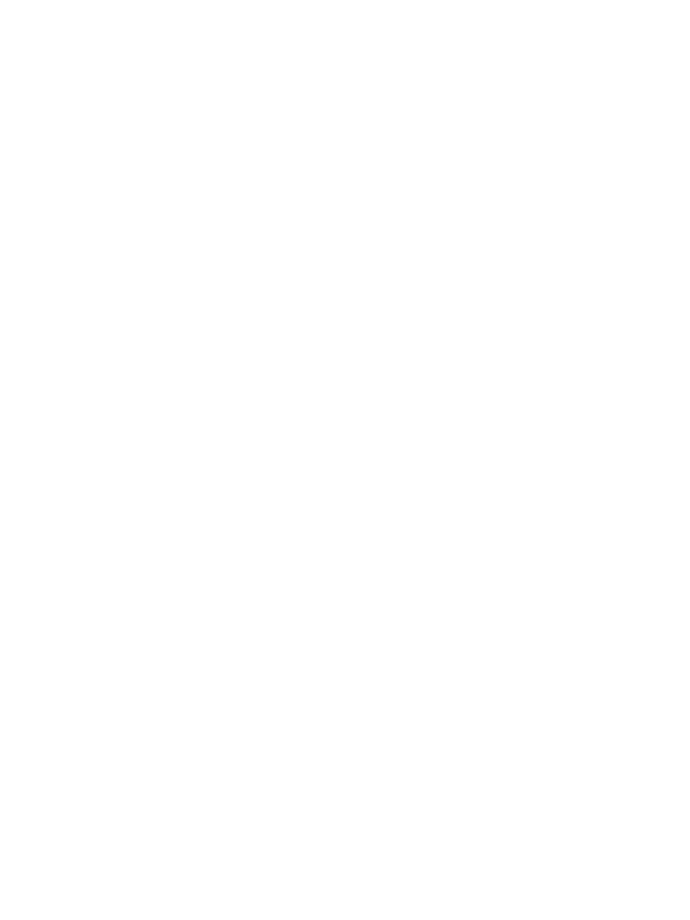
Zerstörtes ziviles Gebäude in Mariupol
Foto mit freundlicher Genehmigung von Marina Pilezkaja
Foto mit freundlicher Genehmigung von Marina Pilezkaja
„Oma, ich bin hungrig, aber man muss lächeln“
Bis zum 2. März saßen wir zu Hause – mein Schwiegersohn, meine Tochter und mein Enkel übernachteten im Badezimmer und mein Mann und ich in unserem Zimmer. Aber als die Angriffe ganz in der Nähe stattfanden, suchten wir nach einem Keller. Wir wollten zum „Haus der Kultur“, doch es begann ein äußerst starker Beschuss – wir kamen nicht ans Ziel. Unter dem Geheul der Raketen rannten wir in eine Art Keller, wo es sehr kalt und feucht war. Die Menschen saßen auf Bänken im engen Flur – man konnte sich nicht einmal hinlegen. Dann flogen Geschosse auch dorthin. Außerdem waren meine Füße nach zehn Minuten so eiskalt, dass mein Mann den „Tawrija“ aus der Garage holte und wir zum Keller zu einer ehemaligen Klassenkameradin meiner Tochter fuhren.
Dort verbrachten wir fast drei Wochen – bis zum 21. März. Medikamente holte ich aus unserem Haus – das, was wir nach Israel mitnehmen wollten. Übrigens wurde im Keller niemand krank, der Körper konzentrierte sich aufs Überleben. Der Beschuss nahm kein Ende, ich verstehe nicht, wie wir bei diesem Donner einschlafen konnten. Wir schliefen auf dem Zementboden, jemand brachte einen Teppich, wir hatten Decken dabei – die wollten wir auch nach Israel mitnehmen. Es herrschte große Kälte – am 10. März setzte Frost ein. Wegen der Angriffe gingen die Kinder nicht nach draußen, mein Enkel, ist sechs Jahre alt, sein Freund fünf, wir lasen ihnen bei Kerzenlicht vor. Als für etwa zehn Minuten Stille einkehrte, versuchten sie die Treppe hochzusteigen, doch man hielt sie davon ab. Die Kinder sahen kein Tageslicht, aber sie wurden schnell erwachsen. „Oma, ich bin hungrig, aber man muss lächeln“, sagte mein Enkel mir einmal.
Als wir Wasser holen gingen, begann der Beschuss – gerade in diesem Augenblick und gerade bei einer großen Menschenansammlung. Praktisch gab es schon kein Wasser mehr. In ein derartiges Mörserfeuer geriet mein Mann – an die 30 Menschen rannten in den Kindergarten, dort gibt es einen Hydranten, und hier begann das Grauen. Sie konnten nirgends in Deckung gehen, es krachte irgendwo ganz in der Nähe. Das war der größte Schrecken meines Lebens. Sie saßen im Flur, zusammengekauert, aber er schoss alle 20 Sekunden – erst zu kurz, dann zu weit, das Mörserfeuer beruhigte sich nicht, bevor es den Haupteingang des Kindergartens traf. Unmengen von Staub wirbelten auf, ein Mädchen drohte zertrampelt zu werden, mein Mann hob es auf und stellte es neben sich. Endlich sahen wir unsere Männer, sie rannten zurück in den Keller mit völlig verstörten Augen…
Bis zum 2. März saßen wir zu Hause – mein Schwiegersohn, meine Tochter und mein Enkel übernachteten im Badezimmer und mein Mann und ich in unserem Zimmer. Aber als die Angriffe ganz in der Nähe stattfanden, suchten wir nach einem Keller. Wir wollten zum „Haus der Kultur“, doch es begann ein äußerst starker Beschuss – wir kamen nicht ans Ziel. Unter dem Geheul der Raketen rannten wir in eine Art Keller, wo es sehr kalt und feucht war. Die Menschen saßen auf Bänken im engen Flur – man konnte sich nicht einmal hinlegen. Dann flogen Geschosse auch dorthin. Außerdem waren meine Füße nach zehn Minuten so eiskalt, dass mein Mann den „Tawrija“ aus der Garage holte und wir zum Keller zu einer ehemaligen Klassenkameradin meiner Tochter fuhren.
Dort verbrachten wir fast drei Wochen – bis zum 21. März. Medikamente holte ich aus unserem Haus – das, was wir nach Israel mitnehmen wollten. Übrigens wurde im Keller niemand krank, der Körper konzentrierte sich aufs Überleben. Der Beschuss nahm kein Ende, ich verstehe nicht, wie wir bei diesem Donner einschlafen konnten. Wir schliefen auf dem Zementboden, jemand brachte einen Teppich, wir hatten Decken dabei – die wollten wir auch nach Israel mitnehmen. Es herrschte große Kälte – am 10. März setzte Frost ein. Wegen der Angriffe gingen die Kinder nicht nach draußen, mein Enkel, ist sechs Jahre alt, sein Freund fünf, wir lasen ihnen bei Kerzenlicht vor. Als für etwa zehn Minuten Stille einkehrte, versuchten sie die Treppe hochzusteigen, doch man hielt sie davon ab. Die Kinder sahen kein Tageslicht, aber sie wurden schnell erwachsen. „Oma, ich bin hungrig, aber man muss lächeln“, sagte mein Enkel mir einmal.
Als wir Wasser holen gingen, begann der Beschuss – gerade in diesem Augenblick und gerade bei einer großen Menschenansammlung. Praktisch gab es schon kein Wasser mehr. In ein derartiges Mörserfeuer geriet mein Mann – an die 30 Menschen rannten in den Kindergarten, dort gibt es einen Hydranten, und hier begann das Grauen. Sie konnten nirgends in Deckung gehen, es krachte irgendwo ganz in der Nähe. Das war der größte Schrecken meines Lebens. Sie saßen im Flur, zusammengekauert, aber er schoss alle 20 Sekunden – erst zu kurz, dann zu weit, das Mörserfeuer beruhigte sich nicht, bevor es den Haupteingang des Kindergartens traf. Unmengen von Staub wirbelten auf, ein Mädchen drohte zertrampelt zu werden, mein Mann hob es auf und stellte es neben sich. Endlich sahen wir unsere Männer, sie rannten zurück in den Keller mit völlig verstörten Augen…

Marinas Sohn, der am 13. März 2022 starb
Foto mit freundlicher Genehmigung von Marina Pilezkaja
Foto mit freundlicher Genehmigung von Marina Pilezkaja
Am Leichenhaus stapelten sich die Leichen – eine in einem Paket, eine andere in einer Decke
Mein Mann war noch nicht wieder zu Atem gekommen, da heißt es, dass unsere junge Nachbarin am Bein und am Rücken verletzt wurde. Die junge Frau ist 21 Jahre alt und hat ein einjähriges Kind. Sie war ins Nachbarhaus gegangen, um Wattestäbchen für ihren Sohn zu holen, und da kam der Luftangriff. Es war niemand da, um zu helfen – sie legten sie einfach auf die Stufen. Also legte mein Mann sie ins Auto und fuhr ins Krankenhaus. Das Bein wurde genäht und dann fuhr mein Mann Vera dreimal unter Beschuss zum Verbandswechsel. Am 21. März gab es dort bereits weder Medikamente, noch Wasser, Strom oder Heizung. Das Gebäude wurde weiter beschossen. Am Leichenschauhaus stapelten sich am Bordstein die Leichen von Zivilisten – einer in einem Paket, ein anderer in einer Decke, mein Mann hat es selbst gesehen. Die Russen beschossen die Häuser, jemand verbrannte, die Leichen lagen oft auf den Straßen herum, es war niemand da, der sie begraben könnte, aber solange es kalt war – lagen die Leichen da, sie wurden nicht einmal zugedeckt.
Am 13. März verschwand mein Sohn – er war in einem anderen Keller. Sie gingen zu dritt Wasser holen und kehrten nicht zurück. Ihr zerschossenes Auto wurde gesehen, aber die Leichen fand man nicht. Es war schrecklich… (Später wurde bekannt, das Marinas Sohn ums Leben gekommen ist – Anm. d. Red.)
Um zu überleben, brachen die Leute in die Geschäfte ein und nahmen sich Lebensmittel mit. Mein Mann eilte zur Lagerhalle und zurück und brachte Tyulka-Sardinen-Presskuchen mit, die wir in unserem Leben noch nie gekauft hatten, wir leben ja am Meer. Aber wir brieten sie auf dem Feuer, man muss doch irgendetwas essen. Wir hatten aus dem Haus einige Vorräte mitgenommen, wir kochten Haferflocken. Das Wasser hatte einen scheußlichen Bodensatz, Sand, man konnte es nicht einmal abkochen. Ungefähr bis zum 15. März hielten wir es irgendwie aus, aber danach konnten wir wegen des schrecklichen Beschusses nicht einmal mehr kurz rauslaufen, um den Teekessel aufs Feuer zu setzen. Die Häuser fielen einfach in sich zusammen und brannten. Fliegerbomben fielen alle 10 bis 20 Minuten und wir ahnten, dass der Keller zu unserem Grab wird.
Der Mann meiner Schwester erlitt Wunden und Prellungen. Ihr Haus brannte und als sie in den Schutzraum hinabstiegen, traf ihn ein Schuss in den Bauch. Niemand konnte ihm helfen, es gab keine Medikamente, auch kein Wasser – nur Verband. Einer meiner Kollegen wurde bei einem Beschuss getötet – seine Frau teilte mir das telefonisch mit.
Bemerkenswert ist, dass 80% der Stadtbevölkerung ziemlich prorussisch eingestellt waren, und diese Leute hat Putin vernichtet. Aber ein Umdenken fand nicht bei allen statt, einige glauben, dass wir uns selbst umbringen. Obwohl einige es verstanden haben. Viele, die nach Russland gebracht wurden, sagen, es sei schrecklich, wie sie dort leben, wie im letzten Jahrhundert.
Mein Mann war noch nicht wieder zu Atem gekommen, da heißt es, dass unsere junge Nachbarin am Bein und am Rücken verletzt wurde. Die junge Frau ist 21 Jahre alt und hat ein einjähriges Kind. Sie war ins Nachbarhaus gegangen, um Wattestäbchen für ihren Sohn zu holen, und da kam der Luftangriff. Es war niemand da, um zu helfen – sie legten sie einfach auf die Stufen. Also legte mein Mann sie ins Auto und fuhr ins Krankenhaus. Das Bein wurde genäht und dann fuhr mein Mann Vera dreimal unter Beschuss zum Verbandswechsel. Am 21. März gab es dort bereits weder Medikamente, noch Wasser, Strom oder Heizung. Das Gebäude wurde weiter beschossen. Am Leichenschauhaus stapelten sich am Bordstein die Leichen von Zivilisten – einer in einem Paket, ein anderer in einer Decke, mein Mann hat es selbst gesehen. Die Russen beschossen die Häuser, jemand verbrannte, die Leichen lagen oft auf den Straßen herum, es war niemand da, der sie begraben könnte, aber solange es kalt war – lagen die Leichen da, sie wurden nicht einmal zugedeckt.
Am 13. März verschwand mein Sohn – er war in einem anderen Keller. Sie gingen zu dritt Wasser holen und kehrten nicht zurück. Ihr zerschossenes Auto wurde gesehen, aber die Leichen fand man nicht. Es war schrecklich… (Später wurde bekannt, das Marinas Sohn ums Leben gekommen ist – Anm. d. Red.)
Um zu überleben, brachen die Leute in die Geschäfte ein und nahmen sich Lebensmittel mit. Mein Mann eilte zur Lagerhalle und zurück und brachte Tyulka-Sardinen-Presskuchen mit, die wir in unserem Leben noch nie gekauft hatten, wir leben ja am Meer. Aber wir brieten sie auf dem Feuer, man muss doch irgendetwas essen. Wir hatten aus dem Haus einige Vorräte mitgenommen, wir kochten Haferflocken. Das Wasser hatte einen scheußlichen Bodensatz, Sand, man konnte es nicht einmal abkochen. Ungefähr bis zum 15. März hielten wir es irgendwie aus, aber danach konnten wir wegen des schrecklichen Beschusses nicht einmal mehr kurz rauslaufen, um den Teekessel aufs Feuer zu setzen. Die Häuser fielen einfach in sich zusammen und brannten. Fliegerbomben fielen alle 10 bis 20 Minuten und wir ahnten, dass der Keller zu unserem Grab wird.
Der Mann meiner Schwester erlitt Wunden und Prellungen. Ihr Haus brannte und als sie in den Schutzraum hinabstiegen, traf ihn ein Schuss in den Bauch. Niemand konnte ihm helfen, es gab keine Medikamente, auch kein Wasser – nur Verband. Einer meiner Kollegen wurde bei einem Beschuss getötet – seine Frau teilte mir das telefonisch mit.
Bemerkenswert ist, dass 80% der Stadtbevölkerung ziemlich prorussisch eingestellt waren, und diese Leute hat Putin vernichtet. Aber ein Umdenken fand nicht bei allen statt, einige glauben, dass wir uns selbst umbringen. Obwohl einige es verstanden haben. Viele, die nach Russland gebracht wurden, sagen, es sei schrecklich, wie sie dort leben, wie im letzten Jahrhundert.
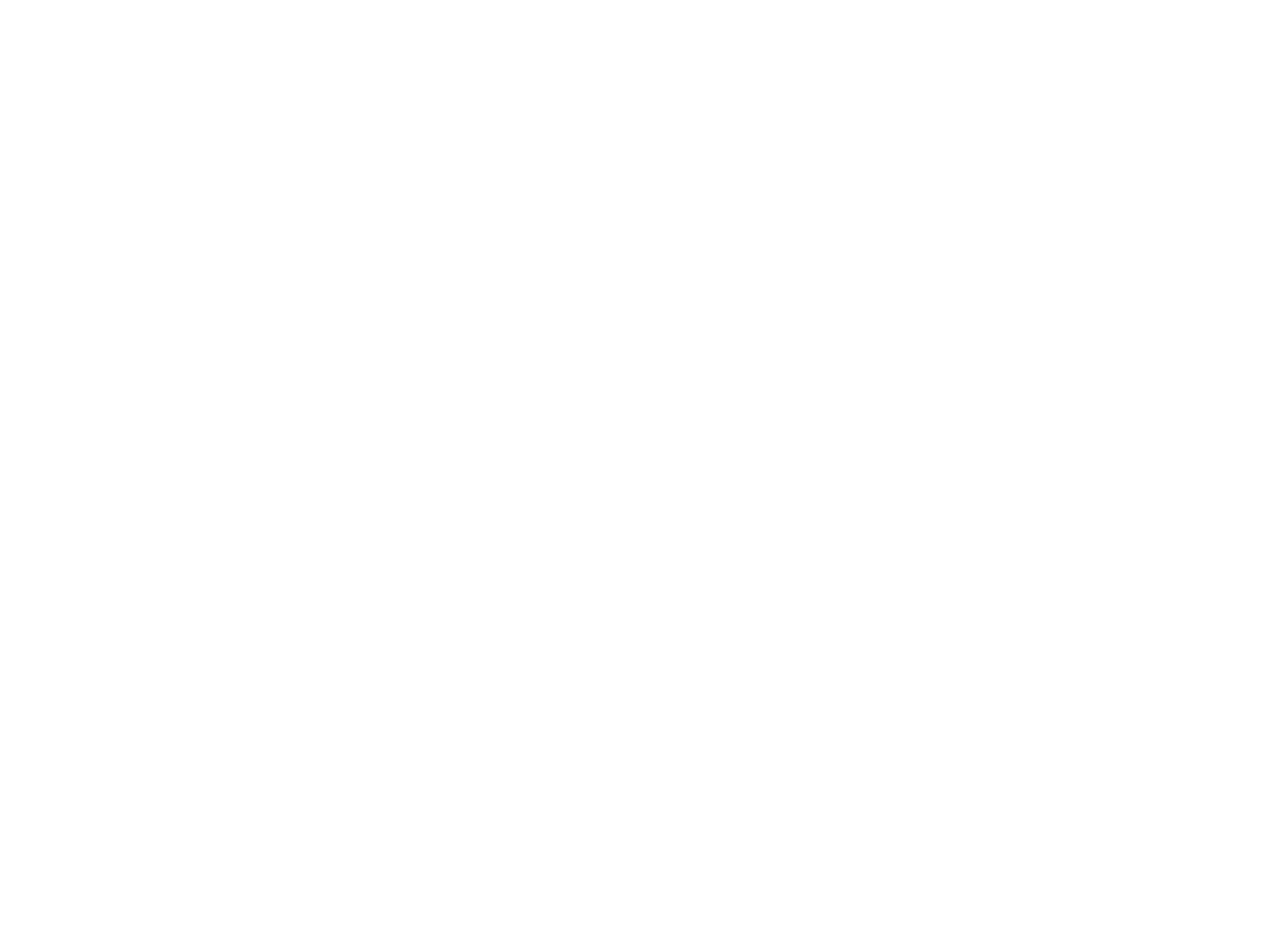
Tanya Moroz, 6 Jahre alt. Eine russische Granate flog in ihr Haus in Mariupol und traf den Schutzraum. Die Mutter versuchte, Tanya mit ihrem Körper zu schützen, sie starb auf der Stelle. Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht, aber russische Flugzeuge bombardierten die Intensivstation des Krankenhauses. Tanya starb.
Grundwehrdienstleistenden waren im Allgemeinen höflich. „Guten Morgen“ und in dieser Art. Wir haben euer Haus zerstört, aber „guten Morgen“
Wir haben unter dem Autositz eine ukrainische Fahne rausgeschmuggelt
Am 21. März hatten inzwischen alle, die ein Auto hatten, beschlossen, die Stadt zu verlassen. Wenn ich daran zurückdenke, beginne ich zu zittern. Als die Autos eine kleine Kolonne gebildet hatten, begann ein Beschuss – offensichtlich hatte sie jemand beobachtet. Aber wir schafften es raus – 5 bis 6 Autos, in einem von ihnen meine Tochter mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Unterwegs verloren wir uns, waren in unserem „Tawrija“ allein auf der Straße wie auf dem Präsentierteller. Auf der Straße sind nicht explodierte Minen, abgerissene Kabel unter den Rädern. Wir beginnen auf den Straßenbahngleisen zu fahren und kommen bis zur Post-Brücke, die zwei Stadtteile verbindet, erblicken einen großen Bombentrichter und uns ist klar, dass wir nicht weiterfahren können.
Wir mussten umkehren, die andere Brücke ist auch zerstört, es blieb noch eine ganz kleine Brücke, über die sind wir dann rübergekommen. Für einen Augenblick gibt es eine Telefonverbindung – meine Tochter ist durchgekommen. Ich sagte, dass wir wegfuhren und die Verbindung brach wieder ab.
Und dann kamen russische Kontrollpunkte, gut fünfzehn nacheinander, buchstäblich alle paar hundert Meter. Sie benahmen sich unterschiedlich. Die Wehrpflichtigen waren im Allgemeinen höflich. „Guten Morgen“ etc. Wir haben euer Haus zerstört, aber „guten Morgen“. Wir hatten zwei Wohnungen – die eine, die wir vor kurzem gekauft hatten, war fast völlig ausgebrannt. Und als sie „guten Morgen“ sagen, weiß ich, dass in meiner Wohnung nichts mehr ist, sie haben schon alles mitgenommen.
An den Kontrollpunkten zogen sie meinen Mann bis auf die Unterhosen aus und durchsuchten das Auto. Hilfreich war der Passierschein von Asow-Stahl – es war klar, dass mein Mann einfacher Arbeiter und kein Soldat war. Am letzten Kontrollpunkt musste auch ich mich ausziehen – dort standen Leute der Volksrepublik Donezk, schrecklich böse Männer, ein Albtraum. Mit so einer Wut sagten sie: „Nehmt die Fahne herunter (an unserem „Tawrija“ war die ukrainische Fahne befestigt) – ein solches Land gibt es nicht. Und warum fahrt ihr überhaupt nach Saporoschje, fahrt in die andere Richtung!“ Natürlich widersprachen wir nicht, mit bewaffneten Leuten streitet man nicht.
Aber eine große Fahne – sie war einen Meter lang – hatten wir zusammengerollt und unter dem Sitz versteckt, wir konnten sie trotzdem rausschmuggeln. Sie bedeutet uns sehr viel. Wenn sie sie gefunden hätten, wäre es nicht gut gewesen, aber wir riskierten es.
Am 21. März hatten inzwischen alle, die ein Auto hatten, beschlossen, die Stadt zu verlassen. Wenn ich daran zurückdenke, beginne ich zu zittern. Als die Autos eine kleine Kolonne gebildet hatten, begann ein Beschuss – offensichtlich hatte sie jemand beobachtet. Aber wir schafften es raus – 5 bis 6 Autos, in einem von ihnen meine Tochter mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Unterwegs verloren wir uns, waren in unserem „Tawrija“ allein auf der Straße wie auf dem Präsentierteller. Auf der Straße sind nicht explodierte Minen, abgerissene Kabel unter den Rädern. Wir beginnen auf den Straßenbahngleisen zu fahren und kommen bis zur Post-Brücke, die zwei Stadtteile verbindet, erblicken einen großen Bombentrichter und uns ist klar, dass wir nicht weiterfahren können.
Wir mussten umkehren, die andere Brücke ist auch zerstört, es blieb noch eine ganz kleine Brücke, über die sind wir dann rübergekommen. Für einen Augenblick gibt es eine Telefonverbindung – meine Tochter ist durchgekommen. Ich sagte, dass wir wegfuhren und die Verbindung brach wieder ab.
Und dann kamen russische Kontrollpunkte, gut fünfzehn nacheinander, buchstäblich alle paar hundert Meter. Sie benahmen sich unterschiedlich. Die Wehrpflichtigen waren im Allgemeinen höflich. „Guten Morgen“ etc. Wir haben euer Haus zerstört, aber „guten Morgen“. Wir hatten zwei Wohnungen – die eine, die wir vor kurzem gekauft hatten, war fast völlig ausgebrannt. Und als sie „guten Morgen“ sagen, weiß ich, dass in meiner Wohnung nichts mehr ist, sie haben schon alles mitgenommen.
An den Kontrollpunkten zogen sie meinen Mann bis auf die Unterhosen aus und durchsuchten das Auto. Hilfreich war der Passierschein von Asow-Stahl – es war klar, dass mein Mann einfacher Arbeiter und kein Soldat war. Am letzten Kontrollpunkt musste auch ich mich ausziehen – dort standen Leute der Volksrepublik Donezk, schrecklich böse Männer, ein Albtraum. Mit so einer Wut sagten sie: „Nehmt die Fahne herunter (an unserem „Tawrija“ war die ukrainische Fahne befestigt) – ein solches Land gibt es nicht. Und warum fahrt ihr überhaupt nach Saporoschje, fahrt in die andere Richtung!“ Natürlich widersprachen wir nicht, mit bewaffneten Leuten streitet man nicht.
Aber eine große Fahne – sie war einen Meter lang – hatten wir zusammengerollt und unter dem Sitz versteckt, wir konnten sie trotzdem rausschmuggeln. Sie bedeutet uns sehr viel. Wenn sie sie gefunden hätten, wäre es nicht gut gewesen, aber wir riskierten es.
Wissen Sie, was das Schrecklichste ist? Wenn man weiß, dass man jeden Augenblick sterben kann, und auch dazu bereit ist. Ich wachte morgens auf, sah meinen Mann neben mir und war dankbar für noch einen Tag, denn jeder konnte der letzte sein
Dann begann unser Auto zu qualmen. Es war zwar ganz geblieben, aber es fehlten die Front- und eine Seitenscheibe – mein Mann hatte sie irgendwie notdürftig verklebt. Wir machten in einem Dorf Halt und plötzlich sah ich einen verpassten Anruf auf Viber. Es war unser Rabbi Mendl Kohen, der angerufen hatte: „Marina, wo seid ihr?!“ Ich erklärte es ihm und er fragte, welche Art Hilfe nötig sei. „Schickt mir die Nummer eurer Karte, ich werde euch Geld überweisen. Wenn ihr in Saporoschje seid, gebt Bescheid, man wird euch unterbringen.“
Früher gab es die „Judenfrage“. Jetzt ist es bei Putin die „Ukrainefrage“
Nach Saporoschje mussten wir manchmal quasi durch Minenfelder fahren. Als wir endlich den ersten „unseren“ Kontrollpunkt erreichten und ich die ukrainischen Rangabzeichen auf den Uniformen der Soldaten sah, sagte ich zu meinem Mann: „Unsere!“ Und wir beide weinten wie Kinder. Als Antwort winkten sie uns zu und versicherten: „Alles wird gut, Sie sind in der Ukraine.“ Damals sagte ich zu meinem Mann, dass ich ein solches Glücksgefühl nicht einmal an unserem Hochzeitstag verspürt habe.
Meine Tochter fuhr mit ihrem Mann auf einer anderen Route, erst beim dritten Versuch kamen sie raus, sie wurden beschossen und mussten sich unter den Rädern verstecken…Wir trafen uns schon in Saparoschje und wurden im Hotel „Intourist“ untergebracht. Einige Tage später brachten sie uns nach Drahobrat und von dort nach Israel.
Unsere Wohnung war zerstört und geplündert, nichts war geblieben. Erst wohnten dort Tschetschenen, jetzt irgendein Soldat. In der anderen Wohnung leben vier Personen, auf dem Hof steht ein Panzer. Mein Schwiegersohn blieb in der Ukraine. Als er zu seinem Haus kam, richteten sie ein Maschinengewehr auf ihn und sagten: „Du kannst nicht nachweisen, dass du hier gewohnt hast, wir erschießen dich.“ Aber es ging nochmal gut.
Als Rav Mendl vorschlug, durch die Krim zu fahren, habe ich sofort gesagt, dass wir nicht durch die Filtration kommen werden. In unseren Facebook-Profilen gibt es proukrainische Posts – wir könnten in den Keller kommen oder einfach erschossen werden. Eine Frau aus unserer Gemeinde hatte erzählt, wie sie die Filtration durchlaufen hatte – das ist entsetzlich.
Wissen Sie, was das Schrecklichste ist? Wenn man weiß, dass man jeden Augenblick sterben kann, und auch dazu bereit ist. Ich wachte morgens auf, sah meinen Mann neben mir und war dankbar für noch einen Tag, denn jeder konnte der letzte sein.
Die Menschen nehmen dies alles unterschiedlich auf. Eine Kollegin, mit der ich viele Jahre befreundet war, lebt schon lange in Belarus. Das letzte Mal telefonierten wir kurz vor dem Krieg. Sie begann zu erzählen, dass Charkiw eine russische Stadt sei. Ich fing keinen Streit mit ihr an, riet ihr nur, den Fernseher auszuschalten. Kein einziges Mal hat sie sich in dieser Zeit dafür interessiert, was mit mir, meinem Mann und meiner Familie war, ob wir überlebt haben. Und dabei waren wir Jahrzehnte befreundet…
Ich bin sehr enttäuscht von diesen Leuten. Ist es so schwer zu verstehen, dass solange keine russischen Soldaten da waren, niemand schoss? Aber sie befreiten uns von allem – vom Leben, von der Arbeit und vom Haus. Wer hat uns daran gehindert, Russisch zu sprechen? Ja, es wurde begonnen, in der Schule Ukrainisch zu unterrichten, wir leben doch in der Ukraine. Früher gab es die „Judenfrage“. Jetzt ist es bei Putin die „Ukrainefrage“ – er will die Ukraine auslöschen.
Und nun sind wir hier. Es ist erstaunlich, wie warmherzig die Menschen es in Israel sind – sie brachten uns alles: Geschirr und einen Kühlschrank und eine Waschmaschine und auch mit Geld halfen sie uns – mir kamen die Tränen.
Wir können nirgendwohin zurückkehren. Mein Mann fand Arbeit in einer Kunststofffabrik und ich wurde “Metapelet“ (Haushelfer), ich betreue zwei Personen. Ich telefoniere oft mit Mariupol – versuche die ehemaligen Kollegen zu überreden, die tote Stadt zu verlassen, nicht zwischen Leichen zu laufen. Den Leuten wird gesagt, ihr seid jetzt Freiwillige. Sie arbeiten für etwas zu essen, räumen Schutt weg, begraben Leichen.
Ein kleiner Junge schrieb neulich auf Facebook: „Die Stadt ist zerstört, aber das Meer ist geblieben.“ Und das ist alles, was von Mariupol geblieben ist – das Meer. Wir waren vor kurzem am Meer in Aschkelon – liegen am Strand und ich erinnere mich, wie unser Meer roch. Dieses Meer riecht nach nichts und ich schließe die Augen und erinnere mich an den Geruch unseres Meeres.
Statt eines Nachworts. Oktober 2023
Wir haben Israel sehr liebgewonnen. Ich erinnere mich, wie mein Mann und ich einmal auf dem Balkon saßen, und er sagte: mein Gott, was für ein Glück, dass wir in dieses wunderbare Land gekommen sind. Ruslan hat den Ulpan absolviert und nimmt weiter Unterricht bei einem Privatlehrer, macht große Fortschritte in Hebräisch. Er wurde mehrmals befördert, vor kurzem zum Brigadier. Der Chef will sogar eine eigene Stelle für Ruslan durchsetzen und ihn als Leiter von drei Werkstätten einsetzen.
Mariupol vermisse ich nicht – es ist nicht mehr meine Stadt. Dort lagen die Leichen meiner Landsleute und ich werde nicht mehr durch diese Straßen laufen können. Vor kurzem besuchten wir Freunde in Deutschland, und am Ende der Reise bemerkte mein Mann, als wir ins Flugzeug stiegen: „Gott sei Dank, wir fliegen nach Hause.“ Und genauso ist es.
Früher gab es die „Judenfrage“. Jetzt ist es bei Putin die „Ukrainefrage“
Nach Saporoschje mussten wir manchmal quasi durch Minenfelder fahren. Als wir endlich den ersten „unseren“ Kontrollpunkt erreichten und ich die ukrainischen Rangabzeichen auf den Uniformen der Soldaten sah, sagte ich zu meinem Mann: „Unsere!“ Und wir beide weinten wie Kinder. Als Antwort winkten sie uns zu und versicherten: „Alles wird gut, Sie sind in der Ukraine.“ Damals sagte ich zu meinem Mann, dass ich ein solches Glücksgefühl nicht einmal an unserem Hochzeitstag verspürt habe.
Meine Tochter fuhr mit ihrem Mann auf einer anderen Route, erst beim dritten Versuch kamen sie raus, sie wurden beschossen und mussten sich unter den Rädern verstecken…Wir trafen uns schon in Saparoschje und wurden im Hotel „Intourist“ untergebracht. Einige Tage später brachten sie uns nach Drahobrat und von dort nach Israel.
Unsere Wohnung war zerstört und geplündert, nichts war geblieben. Erst wohnten dort Tschetschenen, jetzt irgendein Soldat. In der anderen Wohnung leben vier Personen, auf dem Hof steht ein Panzer. Mein Schwiegersohn blieb in der Ukraine. Als er zu seinem Haus kam, richteten sie ein Maschinengewehr auf ihn und sagten: „Du kannst nicht nachweisen, dass du hier gewohnt hast, wir erschießen dich.“ Aber es ging nochmal gut.
Als Rav Mendl vorschlug, durch die Krim zu fahren, habe ich sofort gesagt, dass wir nicht durch die Filtration kommen werden. In unseren Facebook-Profilen gibt es proukrainische Posts – wir könnten in den Keller kommen oder einfach erschossen werden. Eine Frau aus unserer Gemeinde hatte erzählt, wie sie die Filtration durchlaufen hatte – das ist entsetzlich.
Wissen Sie, was das Schrecklichste ist? Wenn man weiß, dass man jeden Augenblick sterben kann, und auch dazu bereit ist. Ich wachte morgens auf, sah meinen Mann neben mir und war dankbar für noch einen Tag, denn jeder konnte der letzte sein.
Die Menschen nehmen dies alles unterschiedlich auf. Eine Kollegin, mit der ich viele Jahre befreundet war, lebt schon lange in Belarus. Das letzte Mal telefonierten wir kurz vor dem Krieg. Sie begann zu erzählen, dass Charkiw eine russische Stadt sei. Ich fing keinen Streit mit ihr an, riet ihr nur, den Fernseher auszuschalten. Kein einziges Mal hat sie sich in dieser Zeit dafür interessiert, was mit mir, meinem Mann und meiner Familie war, ob wir überlebt haben. Und dabei waren wir Jahrzehnte befreundet…
Ich bin sehr enttäuscht von diesen Leuten. Ist es so schwer zu verstehen, dass solange keine russischen Soldaten da waren, niemand schoss? Aber sie befreiten uns von allem – vom Leben, von der Arbeit und vom Haus. Wer hat uns daran gehindert, Russisch zu sprechen? Ja, es wurde begonnen, in der Schule Ukrainisch zu unterrichten, wir leben doch in der Ukraine. Früher gab es die „Judenfrage“. Jetzt ist es bei Putin die „Ukrainefrage“ – er will die Ukraine auslöschen.
Und nun sind wir hier. Es ist erstaunlich, wie warmherzig die Menschen es in Israel sind – sie brachten uns alles: Geschirr und einen Kühlschrank und eine Waschmaschine und auch mit Geld halfen sie uns – mir kamen die Tränen.
Wir können nirgendwohin zurückkehren. Mein Mann fand Arbeit in einer Kunststofffabrik und ich wurde “Metapelet“ (Haushelfer), ich betreue zwei Personen. Ich telefoniere oft mit Mariupol – versuche die ehemaligen Kollegen zu überreden, die tote Stadt zu verlassen, nicht zwischen Leichen zu laufen. Den Leuten wird gesagt, ihr seid jetzt Freiwillige. Sie arbeiten für etwas zu essen, räumen Schutt weg, begraben Leichen.
Ein kleiner Junge schrieb neulich auf Facebook: „Die Stadt ist zerstört, aber das Meer ist geblieben.“ Und das ist alles, was von Mariupol geblieben ist – das Meer. Wir waren vor kurzem am Meer in Aschkelon – liegen am Strand und ich erinnere mich, wie unser Meer roch. Dieses Meer riecht nach nichts und ich schließe die Augen und erinnere mich an den Geruch unseres Meeres.
Statt eines Nachworts. Oktober 2023
Wir haben Israel sehr liebgewonnen. Ich erinnere mich, wie mein Mann und ich einmal auf dem Balkon saßen, und er sagte: mein Gott, was für ein Glück, dass wir in dieses wunderbare Land gekommen sind. Ruslan hat den Ulpan absolviert und nimmt weiter Unterricht bei einem Privatlehrer, macht große Fortschritte in Hebräisch. Er wurde mehrmals befördert, vor kurzem zum Brigadier. Der Chef will sogar eine eigene Stelle für Ruslan durchsetzen und ihn als Leiter von drei Werkstätten einsetzen.
Mariupol vermisse ich nicht – es ist nicht mehr meine Stadt. Dort lagen die Leichen meiner Landsleute und ich werde nicht mehr durch diese Straßen laufen können. Vor kurzem besuchten wir Freunde in Deutschland, und am Ende der Reise bemerkte mein Mann, als wir ins Flugzeug stiegen: „Gott sei Dank, wir fliegen nach Hause.“ Und genauso ist es.
Die Zeugenaussage wurde am 13. Juni 2022 aufgezeichnet
Übersetzung: Dr. Dorothea Kollenbach
Übersetzung: Dr. Dorothea Kollenbach