Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Other cookies are configurable.
Mariupol
Durch Phosphorbomben geriet das in Brand, was nicht brennen kann
Inna Satoloka, Reiseführerin
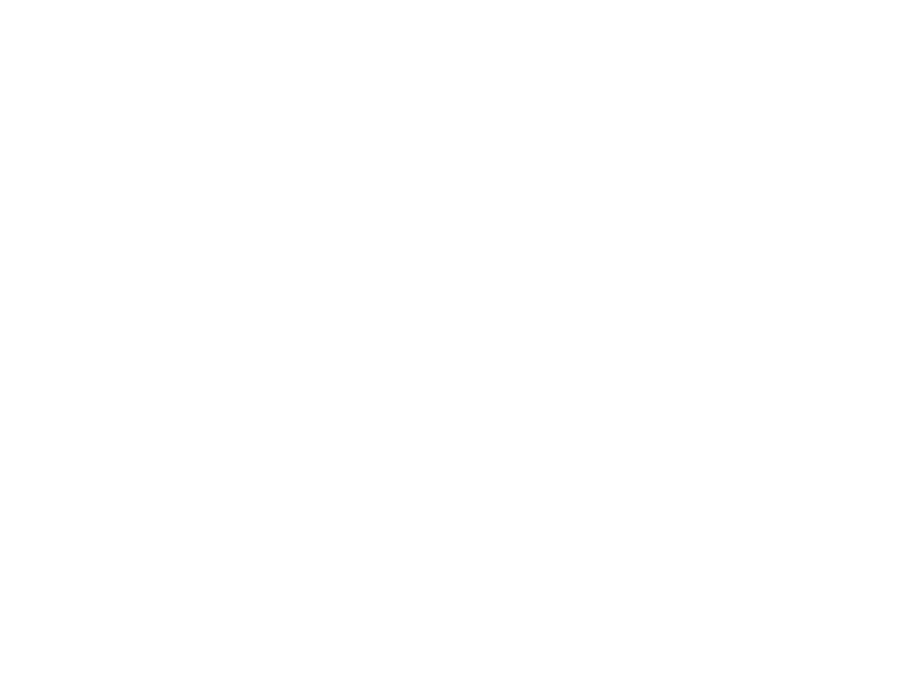
Innas Tante, eine Holocaust-Überlebende
Foto mit freundlicher Genehmigung von Inna Satoloka
Foto mit freundlicher Genehmigung von Inna Satoloka
Am 24. um 4 Uhr morgens wurde ich durch Explosionen wach, ging ins Internet und sah, dass die gesamte Ukraine angegriffen wird. Kurz gesagt – ein Schock. Ich hatte nicht an ein derartiges Szenario geglaubt, aber seit 2014 war klar, dass im Falle eines Krieges Mariupol eines der ersten Ziele sein würde. Die Stadt ist als Hafen und Weg zur Krim von Bedeutung.
Niemand konnte sich das Ausmaß der Katastrophe vorstellen
Am 25. kam ein Freund aus Kiew – Witalij –, um mich und meine Mama aus Mariupol zu holen. Getrennt von uns wohnten meine 86jährige Tante, die den Holocaust überlebt hatte, mit ihrem 93jährigen Ehemann, einem Überlebenden der Blockade von Leningrad. Am 28. Februar holten wir sie zu uns in unser Einfamilienhaus im Zentrum der Stadt. Zu dieser Zeit war es bereits sehr schwierig, sie zu besuchen. Mariupol stand schon unter ständigem Beschuss, die ganze Straße war aufgerissen und voller Bodentrichter von den Einschlägen, verhedderte Kabel lagen herum und Granatensplitter, und falls das Auto beschädigt würde, hätten wir die letzte Chance für eine Evakuierung vertan. Warum wir nicht sofort gefahren sind? Ich konnte meinen Sohn Mark nicht zurücklassen, der im Kombinat „Asow-Stahl“ arbeitete. Ich dachte, wenn wir in dieser Hölle überlebten, würde der Allmächtige uns irgendwie leiten. (Mark verbrachte mehr als sechs Monate in russischer Gefangenschaft auf dem Territorium der sogenannten Donezk Republik und wurde kürzlich im Rahmen eines Austauschs freigelassen – Anm. d. Red.).

Inna vor dem nicht funktionierenden Heizkörper
Foto mit freundlicher Genehmigung von Inna Satoloka
Foto mit freundlicher Genehmigung von Inna Satoloka
Aber niemand konnte sich das Ausmaß der Katastrophe vorstellen, die die Stadt erwartete. Wir versteckten uns im Keller im Hof – es wäre auch im Keller des Hauses möglich gewesen, aber wir fürchteten, dass uns niemand würde ausgraben können, wenn es einstürzte.
Das Jahr 2014 hat uns doch etwas gelehrt: im Haus blieben Getreide, Mehl, Zucker, Tee und ein kleiner Vorrat Wasser. Von all dem konnten wir übrigens nicht Gebrauch machen, weil wir am 18. März bombardiert wurden und fliehen mussten. Die Türen waren verklemmt und Witalij zog mich, meine Mama – sie war Rentnerin – und meine Tante mit ihrem Mann heraus.
So fanden wir uns im Bereich des Hafens wieder – wir hatten dort Verwandte, aber wir waren vom Regen in die Traufe geraten. Wasser schöpften wir aus irgendwelchen Quellen; es war beinahe ungeeignet als Trinkwasser, sehr bitter. Wir kochten es und ließen es dann etwas stehen, aber dennoch bekamen die älteren Leute Nierenprobleme.
Die Lebensmittel waren knapp, wir holten sie aus den zerstörten Häusern in der Nähe, einige Male kehrten wir, um Vorräte zu holen, in unser halb zerfallenes Haus zurück. Eine Dose Schmorfleisch kostete 800 Griwna, eine Stange Zigaretten 10.000, ein Liter Benzin kostete bis 1.000. Aber die Leute waren bereit, jeden Preis zu zahlen, um von Mariupol wegzukommen, und seien es nur 20 Kilometer.
Die Telekommunikation brach Anfang März fast überall zusammen, aber an einer Stelle in der Nähe des Krankenhauses kam man manchmal ins Internet. Doch als wir am 30. März zu einer weiteren „Kommunikationssitzung“ kamen, begann der Beschuss, der letzte Funkturm wurde beschädigt – und seitdem waren wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten.
Auf dem Primorskij Boulevard lagen Leichen, verstreute Gegenstände, Schuhe, Fressnäpfe
Am 8. April wurde durch einen direkten Treffer eines Minenwerfers unsere Unterkunft am Hafen zerstört. Wieder befreite uns Witalij und dann bewegten wir uns einfach im Schachbrettmuster von Haus zu Haus – wo etwas heil geblieben war, dort blieben wir. Es wurde 24/7 geschossen. Artillerie, Marschflugkörper, Minenwerfer, die Marineartillerie – wenn letztere schoss, hatten wir fürchterliche Angst. Aber unser Block wurde auch noch mit Phosphorbomben niedergebrannt. Einmal wurden wir nachts dadurch wach, dass es taghell war, und wir hatten schon vergessen, wie Licht überhaupt aussieht. Das Schauspiel erinnerte an ein Feuerwerk, und sehr bald flogen Phosphorbomben auf uns herab, die kleinen Laternen ähnelten. Sie fielen herab und um sie herum brannte das, was eigentlich nicht brennen kann. Einige Nachbarn versuchten zu löschen, aber vom Wasser wütete die Flamme noch stärker. In kürzester Zeit verbrannten viele Häuser.
Das Jahr 2014 hat uns doch etwas gelehrt: im Haus blieben Getreide, Mehl, Zucker, Tee und ein kleiner Vorrat Wasser. Von all dem konnten wir übrigens nicht Gebrauch machen, weil wir am 18. März bombardiert wurden und fliehen mussten. Die Türen waren verklemmt und Witalij zog mich, meine Mama – sie war Rentnerin – und meine Tante mit ihrem Mann heraus.
So fanden wir uns im Bereich des Hafens wieder – wir hatten dort Verwandte, aber wir waren vom Regen in die Traufe geraten. Wasser schöpften wir aus irgendwelchen Quellen; es war beinahe ungeeignet als Trinkwasser, sehr bitter. Wir kochten es und ließen es dann etwas stehen, aber dennoch bekamen die älteren Leute Nierenprobleme.
Die Lebensmittel waren knapp, wir holten sie aus den zerstörten Häusern in der Nähe, einige Male kehrten wir, um Vorräte zu holen, in unser halb zerfallenes Haus zurück. Eine Dose Schmorfleisch kostete 800 Griwna, eine Stange Zigaretten 10.000, ein Liter Benzin kostete bis 1.000. Aber die Leute waren bereit, jeden Preis zu zahlen, um von Mariupol wegzukommen, und seien es nur 20 Kilometer.
Die Telekommunikation brach Anfang März fast überall zusammen, aber an einer Stelle in der Nähe des Krankenhauses kam man manchmal ins Internet. Doch als wir am 30. März zu einer weiteren „Kommunikationssitzung“ kamen, begann der Beschuss, der letzte Funkturm wurde beschädigt – und seitdem waren wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten.
Auf dem Primorskij Boulevard lagen Leichen, verstreute Gegenstände, Schuhe, Fressnäpfe
Am 8. April wurde durch einen direkten Treffer eines Minenwerfers unsere Unterkunft am Hafen zerstört. Wieder befreite uns Witalij und dann bewegten wir uns einfach im Schachbrettmuster von Haus zu Haus – wo etwas heil geblieben war, dort blieben wir. Es wurde 24/7 geschossen. Artillerie, Marschflugkörper, Minenwerfer, die Marineartillerie – wenn letztere schoss, hatten wir fürchterliche Angst. Aber unser Block wurde auch noch mit Phosphorbomben niedergebrannt. Einmal wurden wir nachts dadurch wach, dass es taghell war, und wir hatten schon vergessen, wie Licht überhaupt aussieht. Das Schauspiel erinnerte an ein Feuerwerk, und sehr bald flogen Phosphorbomben auf uns herab, die kleinen Laternen ähnelten. Sie fielen herab und um sie herum brannte das, was eigentlich nicht brennen kann. Einige Nachbarn versuchten zu löschen, aber vom Wasser wütete die Flamme noch stärker. In kürzester Zeit verbrannten viele Häuser.
Man konnte unmöglich im Keller sitzen, wir wussten nicht, wodurch wir zuerst sterben würden
Am Morgen gingen wir hinaus, um uns umzusehen und nach den Nachbarn zu rufen. Solche Aufrufe nach den Bombardierungen waren sehr wichtig – wir versuchten wenigstens einander zuzuwinken, zu sagen, dass wir überlebt hatten. Aber da sahen wir, dass aus einem Hof eine schmale Blutspur nach draußen geflossen und geronnen war.
Als Witalij noch einmal mit dem Fahrrad losfuhr, um Vorräte aus unserem zerstörten Haus zu holen, standen die Russen schon nebenan. Er betrat das Tor, sie richteten ihre Maschinengewehre auf ihn und fragten, warum er hier herumlaufe. Er sagte zu ihnen: „Jungs, ich will nur Essen holen, bei mir sind alte Leute, ich muss ihnen zu essen geben.“ Sie sagten, also komm nicht wieder her, nimm schnell, was du brauchst, und hau ab. „Aber was macht ihr denn hier“, fragt er. „Ich wohne ja hier.“ „Wir sind auf Stellung“, antworten sie.
Am 12. April versuchten wir noch einmal ins Haus zu kommen – wir fuhren mit Fahrrädern auf dem Primorskij-Boulevard. Das war die Mariupoler Straße des Lebens (Anspielung auf die gleichnamige Rettungsstraße während der Leningrader Blockade – A.d.Ü.), auf ihr ging und fuhr man, hier und da lagen Leichen, sah man verstreute Sachen, Schuhe, Fressnäpfe für Hunde. Hier und da zurückgelassene verendete Tiere – ein Käfig mit einem toten Papagei, ein Einmachglas mit einem toten Zwerghamster – offensichtlich retteten die Menschen das, was ihnen lieb und teuer war…
Näher an der Mitte des Boulevards wurde klar, dass die Russen unseren Bezirk schon gänzlich eingenommen hatten, sie haben sogar nach den Kämpfern des Asow-Bataillons gefragt, sie hatten schreckliche Angst vor ihnen… Wir fuhren weiter, und über unseren Köpfen pfiffen Kugeln – wir mussten uns einfach auf den Boden werfen. Solchen Beschuss hatte es bisher nicht gegeben, am Meer hatte es weniger Luftangriffe gegeben – wozu sollte man es bombardieren. Und der Primorskij Boulevard läuft bei uns direkt an der Meeresküste entlang.
Plötzlich sahen wir, dass aus der Richtung des Bahnhofs zwei Menschen angerannt kommen und schreien: „Wohin fahrt ihr? Dort hat man einen Opa auf seinem Rad erschossen!“ Das war der letzte Tropfen, der das Fass überlaufen ließ, wir kehrten um...
Wir fuhren, schrien und baten, uns nicht zu töten
Am nächsten Tag kreuzten die Russen bei uns auf, es gab schon Straßenkämpfe, eine Säuberung stand bevor und es war klar, dass wir flüchten mussten. Am 14. um 6 Uhr morgens fassten wir den endgültigen Beschluss, denn wenn wir alle umkamen, würde mein Sohn seine gesamte Familie auf einmal verlieren. Als wir abfuhren, zeigte das Thermometer im Auto 1°C. Vorher herrschte eine schreckliche Kälte, -10 Grad draußen. Man konnte unmöglich im Keller sitzen, wir wussten nicht, wodurch wir zuerst sterben würden.
Als Witalij noch einmal mit dem Fahrrad losfuhr, um Vorräte aus unserem zerstörten Haus zu holen, standen die Russen schon nebenan. Er betrat das Tor, sie richteten ihre Maschinengewehre auf ihn und fragten, warum er hier herumlaufe. Er sagte zu ihnen: „Jungs, ich will nur Essen holen, bei mir sind alte Leute, ich muss ihnen zu essen geben.“ Sie sagten, also komm nicht wieder her, nimm schnell, was du brauchst, und hau ab. „Aber was macht ihr denn hier“, fragt er. „Ich wohne ja hier.“ „Wir sind auf Stellung“, antworten sie.
Am 12. April versuchten wir noch einmal ins Haus zu kommen – wir fuhren mit Fahrrädern auf dem Primorskij-Boulevard. Das war die Mariupoler Straße des Lebens (Anspielung auf die gleichnamige Rettungsstraße während der Leningrader Blockade – A.d.Ü.), auf ihr ging und fuhr man, hier und da lagen Leichen, sah man verstreute Sachen, Schuhe, Fressnäpfe für Hunde. Hier und da zurückgelassene verendete Tiere – ein Käfig mit einem toten Papagei, ein Einmachglas mit einem toten Zwerghamster – offensichtlich retteten die Menschen das, was ihnen lieb und teuer war…
Näher an der Mitte des Boulevards wurde klar, dass die Russen unseren Bezirk schon gänzlich eingenommen hatten, sie haben sogar nach den Kämpfern des Asow-Bataillons gefragt, sie hatten schreckliche Angst vor ihnen… Wir fuhren weiter, und über unseren Köpfen pfiffen Kugeln – wir mussten uns einfach auf den Boden werfen. Solchen Beschuss hatte es bisher nicht gegeben, am Meer hatte es weniger Luftangriffe gegeben – wozu sollte man es bombardieren. Und der Primorskij Boulevard läuft bei uns direkt an der Meeresküste entlang.
Plötzlich sahen wir, dass aus der Richtung des Bahnhofs zwei Menschen angerannt kommen und schreien: „Wohin fahrt ihr? Dort hat man einen Opa auf seinem Rad erschossen!“ Das war der letzte Tropfen, der das Fass überlaufen ließ, wir kehrten um...
Wir fuhren, schrien und baten, uns nicht zu töten
Am nächsten Tag kreuzten die Russen bei uns auf, es gab schon Straßenkämpfe, eine Säuberung stand bevor und es war klar, dass wir flüchten mussten. Am 14. um 6 Uhr morgens fassten wir den endgültigen Beschluss, denn wenn wir alle umkamen, würde mein Sohn seine gesamte Familie auf einmal verlieren. Als wir abfuhren, zeigte das Thermometer im Auto 1°C. Vorher herrschte eine schreckliche Kälte, -10 Grad draußen. Man konnte unmöglich im Keller sitzen, wir wussten nicht, wodurch wir zuerst sterben würden.

Inna mit ihrer Tante Elvira, einer Überlebenden des Holocaust
Foto mit freundlicher Genehmigung von Inna Satoloka
Foto mit freundlicher Genehmigung von Inna Satoloka

Foto mit freundlicher Genehmigung von Inna Satoloka
Das Auto versteckten wir in einem Schuppen – es war ein Diesel und deshalb heiß begehrt. Die Volksrepublik-Donezk-Leute konfiszierten manchmal Autos. Außerdem war ausreichend Diesel da, im Gegensatz zu Benzin. Witalij entblößte seinen Oberkörper bis zur Taille, um zu zeigen, dass er nicht bewaffnet war und dass auf seinem Körper keine Abdrücke von Waffen waren. Er stieg in weiße Tücher gehüllt auf das Fahrrad und fuhr voraus. Ich saß am Steuer des Wagens. Mama und die Tante winkten mit weißen Handtüchern, sie hatten alle Fenster geöffnet. Sie schafften es nur mit Mühe, den Mann der Tante ins Auto zu setzen, er verstand kaum noch, was vor sich ging und konnte kaum gehen (Nikolaj Alekseewitsch starb schon in Kiew am 16. Juni 2022 – Anm. d. Red.). Außer den Verwandten nahmen wir noch zwei Hunde mit, von denen einer verwundet war.
Die Entscheidung war richtig, mit Witalij am Steuer hätten sie uns erschossen – ein männlicher Fahrer in einem schwarzen Auto und das auch noch, wo kaum noch zivile Fahrzeuge vorhanden waren. Die Straße hatte sich schon lange in Matsch verwandelt, so eine Art Brei aus Beton, Erdklumpen, nicht explodierten Geschossen, Teilen von Dächern und Bruchstücken von Zäunen.
Wir durchbohrten die Reifen schon beim Verlassen der Garage, fuhren nur auf den Felgen und sehr langsam. Witalij zeigte, wo ich ausweichen sollte, um wenigstens nicht auf Geschosse zu treffen. Wir fuhren und schrien, wir sprachen Psalm 90, wir flehten darum, uns nicht zu töten, weinten – wir hatten schreckliche Angst. Buchstäblich alle 200 Meter ein Kontrollposten, viele Leute mit Maschinengewehren. Wenn sie sich näherten, bat Witalij: „Jungs, nicht schießen – hinter mir sind nur eine Frau und alte Menschen.“
Die Entscheidung war richtig, mit Witalij am Steuer hätten sie uns erschossen – ein männlicher Fahrer in einem schwarzen Auto und das auch noch, wo kaum noch zivile Fahrzeuge vorhanden waren. Die Straße hatte sich schon lange in Matsch verwandelt, so eine Art Brei aus Beton, Erdklumpen, nicht explodierten Geschossen, Teilen von Dächern und Bruchstücken von Zäunen.
Wir durchbohrten die Reifen schon beim Verlassen der Garage, fuhren nur auf den Felgen und sehr langsam. Witalij zeigte, wo ich ausweichen sollte, um wenigstens nicht auf Geschosse zu treffen. Wir fuhren und schrien, wir sprachen Psalm 90, wir flehten darum, uns nicht zu töten, weinten – wir hatten schreckliche Angst. Buchstäblich alle 200 Meter ein Kontrollposten, viele Leute mit Maschinengewehren. Wenn sie sich näherten, bat Witalij: „Jungs, nicht schießen – hinter mir sind nur eine Frau und alte Menschen.“
Foto mit freundlicher Genehmigung von Inna Satoloka
Wir fuhren und schrieen, wir lasen Psalm 90, wir baten darum, nicht zu töten, weinten – es war sehr schrecklich
Die Republik-Donezk-Leute, die sich in der Stadt mit Tschetschenen abwechselten, waren nicht ganz bei Sinnen. Einer schimpfte mich an: „Ich erschieße dich gleich, zeig, was im Auto ist!“ Andererseits ist ringsherum die Hölle – und da fährt ein einziges Auto, das sieht sehr verdächtig aus. Außerhalb der Stadt waren es Kontrollposten der regulären russischen Armee. Die benahmen sich nicht so grob.
Wir entgingen dem Filtrationslager dank dem Blockadenüberlebenden
So gelangten wir nach Mangusch – Witalij voraus auf dem Fahrrad, ich auf den zerstochenen Reifen 50 Meter hinter ihm… Dort war ein Filtrations-Lager, aber wir durchliefen keine Filtration – die Alten hätten es nicht überlebt. Wir waren in der Warteschlange als viertausend-irgendwas-undachtzigste an der Reihe. Man sagte, wir würden im Laufe einer Woche abgefertigt sein. Aber wo übernachten, wovon sich ernähren? Man konnte dort nirgends wohnen, es war ein Menschenmeer, wir hatten uns 50 Tage nicht gewaschen, die Alten waren krank, wir hatten zwei Hunde…
Alles in allem fuhren wir aufs Geratewohl; an jedem Kontrollposten sagten wir, dass wir einen Überlebenden der Leningrader Blockade mit uns führten – das war die reine Wahrheit. Nikolaj Alekseewitsch hatte 870 Tage in der Blockade ausgeharrt. Ein russischer Marineoffizier, die Blockade hat er überlebt und jetzt wird er sterben, weil ihr ihn nicht durchlasst – so fuhren wir, indem wir den Mann meiner Tante wie einen Passierschein vorzeigten. Auch das war ein Wunder, weil es keinen Korridor gab, die Fahrzeuge hinter uns kehrten um, während wir bei jedem Kontrollpunkt immer ein und denselben Satz wiederholten. Der erste ukrainische Posten war in Nowodanilowka bei Saporosche. Wir weinten und konnten nicht glauben, dass wir unter den Unseren waren. Wir hatten auch Tante Elvira dabei – sie hat ihre eigene Geschichte.
Wir entgingen dem Filtrationslager dank dem Blockadenüberlebenden
So gelangten wir nach Mangusch – Witalij voraus auf dem Fahrrad, ich auf den zerstochenen Reifen 50 Meter hinter ihm… Dort war ein Filtrations-Lager, aber wir durchliefen keine Filtration – die Alten hätten es nicht überlebt. Wir waren in der Warteschlange als viertausend-irgendwas-undachtzigste an der Reihe. Man sagte, wir würden im Laufe einer Woche abgefertigt sein. Aber wo übernachten, wovon sich ernähren? Man konnte dort nirgends wohnen, es war ein Menschenmeer, wir hatten uns 50 Tage nicht gewaschen, die Alten waren krank, wir hatten zwei Hunde…
Alles in allem fuhren wir aufs Geratewohl; an jedem Kontrollposten sagten wir, dass wir einen Überlebenden der Leningrader Blockade mit uns führten – das war die reine Wahrheit. Nikolaj Alekseewitsch hatte 870 Tage in der Blockade ausgeharrt. Ein russischer Marineoffizier, die Blockade hat er überlebt und jetzt wird er sterben, weil ihr ihn nicht durchlasst – so fuhren wir, indem wir den Mann meiner Tante wie einen Passierschein vorzeigten. Auch das war ein Wunder, weil es keinen Korridor gab, die Fahrzeuge hinter uns kehrten um, während wir bei jedem Kontrollpunkt immer ein und denselben Satz wiederholten. Der erste ukrainische Posten war in Nowodanilowka bei Saporosche. Wir weinten und konnten nicht glauben, dass wir unter den Unseren waren. Wir hatten auch Tante Elvira dabei – sie hat ihre eigene Geschichte.
Meine Nichte erzählt Ihnen, wie sie zwei Alte trafen, die sich blutend dahinschleppten, sich an den Händen haltend, während ringsum Granaten und Bomben fielen. Sie blieben stehen und fragten, Kinder, sind wir auf dem richtigen Weg aus dieser Blockade?
Elvira Michajlowna:
Mein Vater war ein Enkel des Oberrabbiners von Priasow und meine Mutter war Kosakin. Als der Krieg ausbrach, war ich 6 Jahre alt. Mein Vater wurde eingezogen, meine Mutter tauchte unter, damit man mich nicht durch ihre Spur finden konnte. Mich versteckten einfache, sehr ehrliche und gute Menschen, denn für das Verstecken eines solchen Kindes liefen sie Gefahr, auf der Stelle erschossen zu werden. Zwei Jahre lang wurde Jagd auf mich gemacht. Man versteckte mich in Kellern, auf Dachböden – wie es gerade möglich war. Die letzten Monate vor der Befreiung von Mariupol lebte ich im Versteck mit einem Mädchen, das durch ein Wunder der Erschießung entgangen war. Wir lebten in einer Erdhütte in einem Trockental, dort war alles mit Gebüsch überwuchert. Dort erkrankte ich an Typhus und Lungenentzündung. Ich wurde Anfang September 1943 befreit.
Und jetzt konnten wir gerade einen halben Tag vor der vollständigen Blockade fliehen. Niemals hätte ich gedacht, dass unser Nachbarland so handeln würde. Als wir wegfuhren, hielten sie uns am Kontrollpunkt an. Ein Soldat prüfte die Papiere meines Mannes und fragte, was schwerer gewesen sei, diese Blockade oder jene? Ich sah ihn an und sagte: „Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Blockade sinnloser und totaler ist, und die Waffen viel schwerer als vor 80 Jahren.“
Meine Nichte erzählt Ihnen/wird Ihnen erzählen, wie sie zwei Alte trafen, die sich blutend dahinschleppten, sich an den Händen haltend, während ringsum Granaten und Bomben fielen. Sie blieben stehen und fragten, Kinder, sind wir auf dem richtigen Weg aus dieser Blockade? Und sie waren nicht alleine, einige gingen auf Krücken, andere mit Rollatoren, es floss Blut – ein furchtbarer Anblick. Wenn die Flugzeuge Bomben warfen, schleppte man sich einfach irgendwohin in Deckung, so gut man konnte.
Inna Satoloka:
Den 14. April betrachten wir als unseren zweiten Geburtstag. Gott sei Dank sind wir herausgekommen, sind jetzt in Kiew und richten uns ein. Mariupol wurde einfach vom Angesicht der Erde getilgt. Eine meiner Tanten und eine Kusine leben in Russland – jetzt haben wir keinen Kontakt zu ihnen. Als das alles anfing, rief die Kusine an und sagte: „Wir finden das alles natürlich nicht gut.“ Meiner Meinung nach waren das nicht ganz passende Worte, es klang rein formal. Aber die Worte, die unseren Beziehungen ein Ende setzten, kamen aus dem Mund meiner Tante, einer klugen und gebildeten Frau: „Keine Sorge. Sie werden eure Nazis punktuell töten und wir machen aus euch ein zweites Finnland“, sagte sie zu meiner Mama. Und dabei wusste sie, dass mein Sohn Soldat ist und in Mariupol dient. Früher war ich nicht so kategorisch, wollte den Hass nicht reinlassen. Aber heute… Mariupol existiert nicht mehr. Einer unserer Nachbarn bekleidete einen verantwortungsvollen Posten, ihm wurde die Anzahl der Todesfälle mitgeteilt. Am 16. März waren offiziell 20.000 Opfer unter der Zivilbevölkerung registriert. Aber wie viele sind es heute?
P.S. Elvira Michajlowna Borz verstarb in Kiew am 17. Dezember 2023.
Mein Vater war ein Enkel des Oberrabbiners von Priasow und meine Mutter war Kosakin. Als der Krieg ausbrach, war ich 6 Jahre alt. Mein Vater wurde eingezogen, meine Mutter tauchte unter, damit man mich nicht durch ihre Spur finden konnte. Mich versteckten einfache, sehr ehrliche und gute Menschen, denn für das Verstecken eines solchen Kindes liefen sie Gefahr, auf der Stelle erschossen zu werden. Zwei Jahre lang wurde Jagd auf mich gemacht. Man versteckte mich in Kellern, auf Dachböden – wie es gerade möglich war. Die letzten Monate vor der Befreiung von Mariupol lebte ich im Versteck mit einem Mädchen, das durch ein Wunder der Erschießung entgangen war. Wir lebten in einer Erdhütte in einem Trockental, dort war alles mit Gebüsch überwuchert. Dort erkrankte ich an Typhus und Lungenentzündung. Ich wurde Anfang September 1943 befreit.
Und jetzt konnten wir gerade einen halben Tag vor der vollständigen Blockade fliehen. Niemals hätte ich gedacht, dass unser Nachbarland so handeln würde. Als wir wegfuhren, hielten sie uns am Kontrollpunkt an. Ein Soldat prüfte die Papiere meines Mannes und fragte, was schwerer gewesen sei, diese Blockade oder jene? Ich sah ihn an und sagte: „Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Blockade sinnloser und totaler ist, und die Waffen viel schwerer als vor 80 Jahren.“
Meine Nichte erzählt Ihnen/wird Ihnen erzählen, wie sie zwei Alte trafen, die sich blutend dahinschleppten, sich an den Händen haltend, während ringsum Granaten und Bomben fielen. Sie blieben stehen und fragten, Kinder, sind wir auf dem richtigen Weg aus dieser Blockade? Und sie waren nicht alleine, einige gingen auf Krücken, andere mit Rollatoren, es floss Blut – ein furchtbarer Anblick. Wenn die Flugzeuge Bomben warfen, schleppte man sich einfach irgendwohin in Deckung, so gut man konnte.
Inna Satoloka:
Den 14. April betrachten wir als unseren zweiten Geburtstag. Gott sei Dank sind wir herausgekommen, sind jetzt in Kiew und richten uns ein. Mariupol wurde einfach vom Angesicht der Erde getilgt. Eine meiner Tanten und eine Kusine leben in Russland – jetzt haben wir keinen Kontakt zu ihnen. Als das alles anfing, rief die Kusine an und sagte: „Wir finden das alles natürlich nicht gut.“ Meiner Meinung nach waren das nicht ganz passende Worte, es klang rein formal. Aber die Worte, die unseren Beziehungen ein Ende setzten, kamen aus dem Mund meiner Tante, einer klugen und gebildeten Frau: „Keine Sorge. Sie werden eure Nazis punktuell töten und wir machen aus euch ein zweites Finnland“, sagte sie zu meiner Mama. Und dabei wusste sie, dass mein Sohn Soldat ist und in Mariupol dient. Früher war ich nicht so kategorisch, wollte den Hass nicht reinlassen. Aber heute… Mariupol existiert nicht mehr. Einer unserer Nachbarn bekleidete einen verantwortungsvollen Posten, ihm wurde die Anzahl der Todesfälle mitgeteilt. Am 16. März waren offiziell 20.000 Opfer unter der Zivilbevölkerung registriert. Aber wie viele sind es heute?
P.S. Elvira Michajlowna Borz verstarb in Kiew am 17. Dezember 2023.
Die Zeugenaussage wurde am 5. Mai 2022 aufgezeichnet
Übersetzung: Dr. Dorothea Kollenbach
Übersetzung: Dr. Dorothea Kollenbach