Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Other cookies are configurable.
Mariupol
Ein Körper ohne Arme, Beine und Kopf lag da wie Abfall auf dem Weg
Darja Baek, Hausfrau, israelische Staatsbürgerin

Darja mit ihrer Tochter
Foto mit freundlicher Genehmigung von Darja Baek
Foto mit freundlicher Genehmigung von Darja Baek
Ich bin in Mariupol geboren, lebe seit 11 Jahren in Israel und bekam vor kurzem eine Tochter. Am 25. Januar kam ich in meine Heimatstadt, um meinen Eltern ihre Enkelin zu zeigen. Am 24. Februar um 5:30 morgens rief mich mein Mann aus Israel an und sagte: „Nimm die Kleine und fahre zu meiner Mama nach Brazlaw“ (Faina Baek ist Leiterin der jüdischen Gemeinde Brazlaw; Anmerkung der Redaktion). Aber wie sollte man quer durch die ganze Ukraine fahren, wenn Krieg ist?
Am selben Tag begann der Beschuss, heulten Sirenen, flogen „Grad“-Raketen, eine heftige Explosion dröhnte – die Russen bombardierten die Landebahn des Flughafens. Mama fuhr zu meiner Schwester und meinem Bruder, um die ganze Familie an einem Ort zu versammeln. Während ich alleine war, versteckte ich mich im Badezimmer. Ich hörte, wie ein Panzer das Feuer erwiderte…
Am selben Tag begann der Beschuss, heulten Sirenen, flogen „Grad“-Raketen, eine heftige Explosion dröhnte – die Russen bombardierten die Landebahn des Flughafens. Mama fuhr zu meiner Schwester und meinem Bruder, um die ganze Familie an einem Ort zu versammeln. Während ich alleine war, versteckte ich mich im Badezimmer. Ich hörte, wie ein Panzer das Feuer erwiderte…
Darjas Tochter. Ihr erstes Geschenk im Haus der Eltern in Mariupol.
Foto mit freundlicher Genehmigung von Darja Baek
Schauspielhaus von Mariupol, Anfang 2022. Am 16. März 2022 wurde das Theater von russischen Truppen bombardiert, wobei Hunderte von Zivilisten getötet wurden.
Foto mit freundlicher Genehmigung von Darja Baek
Versteckt im Keller.
Foto mit freundlicher Genehmigung von Darja Baek

Versteckt im Keller
Foto mit freundlicher Genehmigung von Darja Baek
Foto mit freundlicher Genehmigung von Darja Baek
Alkohol und Zigaretten wurden zur einzigen Währung
Wir wohnten in der Nähe der Iljitsch Eisen- und Stahlwerke – das ist eine ruhige Gegend, die aber nicht weit vom Stadtzentrum entfernt ist. Tagtäglich wurde die Situation schlechter, das Nachbarhaus wurde von einem Panzer zerschossen. In der ersten Woche gingen wir noch aus dem Keller in die Wohnung hoch, aber dann begaben sich alle in den Luftschutzraum. Dort kamen mehr als 50 Leute unter, es waren drei große Räume, es kamen auch Menschen aus anderen Häusern. Mein Bruder nahm die Batterie aus seinem Auto und installierte Stromleitungen, irgendwie richteten wir uns ein.
Sofort begannen wir Essensvorräte anzulegen, Mama hatte ein kleines Lebensmittelgeschäft – das war auch eine Hilfe. Am nächsten Tag begann die Plünderei und einige Tage später war nichts mehr da. Irgendwann verlor das Geld seinen Wert und Alkohol und Zigaretten wurden zur einzigen Währung.
In unserem Keller litt niemand Hunger – wir teilten alles miteinander. Schon bald wurden Wasser, Netzverbindung, Strom und Gas abgestellt. Wir sparten Wasser, aber das war schwierig – Essen musste gekocht werden, man musste trinken, den Kindern den Popo waschen. Wir waren mit den Kindern zu neunt – die Schwester hat eine Familie, der Bruder ebenso. Allein für einen Topf Suppe und Brei gingen am Tag 14 Liter Wasser drauf. Papa hatte ein großes Aquarium mit 70 Litern Wasser, der Fisch starb, und wir bekamen das Wasser. Außerdem wurden aus dem Boiler zu Hause noch 90 Liter entleert. Und wir stellten auch Eimer auf, um Regenwasser zu sammeln.
In 25 Minuten Fußweg war ein Park. Dort sammelten die Menschen Feuerholz – unter Beschuss. Einige Bekannte gingen dorthin und kehrten nicht zurück. Wir mussten zum Glück nur einmal hingehen.
Kaum hatte man das Gas abgestellt, rannten die Leute los, um Bäume und Äste abzubrechen und irgendwelches Brennholz zu suchen. Sie kochten auf dem Feuer. Früh am Morgen gingen sie hinaus und kochten für den ganzen Tag – und über ihren Köpfen flogen Geschosse. Ich stillte meine Tochter und hatte schon begonnen, ihr Beikost zu geben, so dass sie dasselbe aß wie wir – es gab nichts anderes.
Wir wohnten in der Nähe der Iljitsch Eisen- und Stahlwerke – das ist eine ruhige Gegend, die aber nicht weit vom Stadtzentrum entfernt ist. Tagtäglich wurde die Situation schlechter, das Nachbarhaus wurde von einem Panzer zerschossen. In der ersten Woche gingen wir noch aus dem Keller in die Wohnung hoch, aber dann begaben sich alle in den Luftschutzraum. Dort kamen mehr als 50 Leute unter, es waren drei große Räume, es kamen auch Menschen aus anderen Häusern. Mein Bruder nahm die Batterie aus seinem Auto und installierte Stromleitungen, irgendwie richteten wir uns ein.
Sofort begannen wir Essensvorräte anzulegen, Mama hatte ein kleines Lebensmittelgeschäft – das war auch eine Hilfe. Am nächsten Tag begann die Plünderei und einige Tage später war nichts mehr da. Irgendwann verlor das Geld seinen Wert und Alkohol und Zigaretten wurden zur einzigen Währung.
In unserem Keller litt niemand Hunger – wir teilten alles miteinander. Schon bald wurden Wasser, Netzverbindung, Strom und Gas abgestellt. Wir sparten Wasser, aber das war schwierig – Essen musste gekocht werden, man musste trinken, den Kindern den Popo waschen. Wir waren mit den Kindern zu neunt – die Schwester hat eine Familie, der Bruder ebenso. Allein für einen Topf Suppe und Brei gingen am Tag 14 Liter Wasser drauf. Papa hatte ein großes Aquarium mit 70 Litern Wasser, der Fisch starb, und wir bekamen das Wasser. Außerdem wurden aus dem Boiler zu Hause noch 90 Liter entleert. Und wir stellten auch Eimer auf, um Regenwasser zu sammeln.
In 25 Minuten Fußweg war ein Park. Dort sammelten die Menschen Feuerholz – unter Beschuss. Einige Bekannte gingen dorthin und kehrten nicht zurück. Wir mussten zum Glück nur einmal hingehen.
Kaum hatte man das Gas abgestellt, rannten die Leute los, um Bäume und Äste abzubrechen und irgendwelches Brennholz zu suchen. Sie kochten auf dem Feuer. Früh am Morgen gingen sie hinaus und kochten für den ganzen Tag – und über ihren Köpfen flogen Geschosse. Ich stillte meine Tochter und hatte schon begonnen, ihr Beikost zu geben, so dass sie dasselbe aß wie wir – es gab nichts anderes.
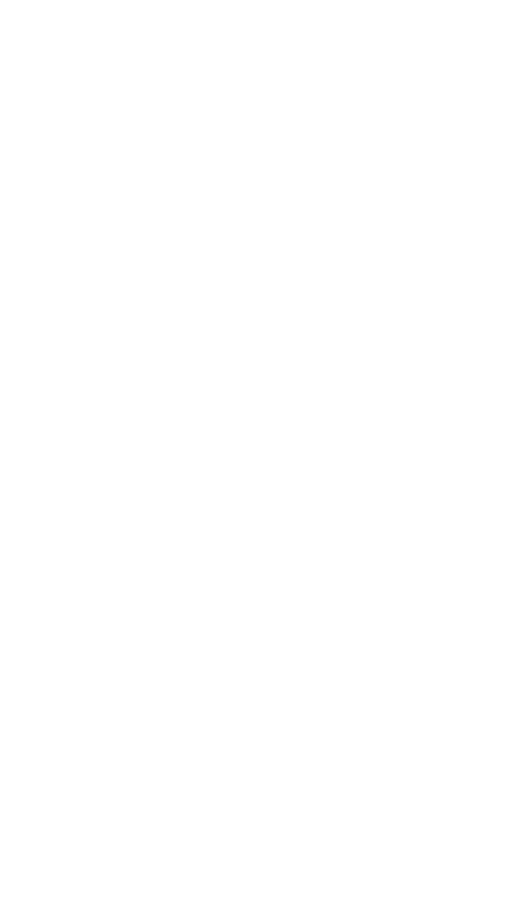
Darja mit ihrer Großmutter, die später an einem Herzinfarkt starb und im Garten begraben wurde. Das Foto wurde in ihrer Wohnung aufgenommen.
Foto mit freundlicher Genehmigung von Darja Baek
Foto mit freundlicher Genehmigung von Darja Baek
Einmal flog ein Geschoss aus einem Minenwerfer in unseren Hof, ein Nachbar wurde getötet – er lag auf der Straße. Immerhin war es kalt. Die Leute wurden einfach zugedeckt und an den Brüstungen zurückgelassen. Allmählich begann man die Leichen zu begraben – als wir die Stadt verließen, sahen wir in jedem Hof einen Mini-Friedhof. Und in unserem Hof ebenso. Zur Zeit der Evakuierung war in unserem Hof ein Friedhof mit 10 Gräbern und die Leute hoben noch weitere Gruben aus. In einem anderen Stadtteil begruben die Nachbarn am 3. April unsere Großmutter – auf einem selbst angelegten Friedhof im Hof. Sie war an einem Herzinfarkt verstorben, aber wir konnten nicht kommen, um sie zu beerdigen.
Einmal verletzte ich mich am Arm und die Wunde infizierte sich. Zwei Tage danach begann die Entzündung, der Ellbogenbereich schwoll an, die Temperatur stieg – und überhaupt wurde es mit jedem Tag schlimmer. Die Nachbarn brachten irgendwelche Salben – nichts half, ich brauchte Antibiotika. Aber woher sollte man sie bekommen? Ein Bursche sagte, dass einige Häuser von uns entfernt ein Arzt im Keller sei, wir liefen unter dem Pfeifen von Geschossen dorthin – da sah ich zum ersten Mal zerstörte Häuser.
Er sah sich meinen Arm an, verschrieb eine Behandlung mit Antibiotika zur intramuskulären Injektion. Das hieß, ich durfte nicht weiter stillen. Meine Schwester half aus – sie hatte auch einen Säugling und stillte beide. Wir machten uns in den Kellern auf die Suche nach Antibiotika – nichts. Doch da gab uns ein Mann die Adresse einer Frau, die nach einer Operation im Bett liegen musste und Antibiotika nahm. Die Eltern hatten Zigaretten und Alkohol aus ihrem Geschäft – sie bezahlten die Ärzte und kauften die notwendigen Medikamente.
Einmal verletzte ich mich am Arm und die Wunde infizierte sich. Zwei Tage danach begann die Entzündung, der Ellbogenbereich schwoll an, die Temperatur stieg – und überhaupt wurde es mit jedem Tag schlimmer. Die Nachbarn brachten irgendwelche Salben – nichts half, ich brauchte Antibiotika. Aber woher sollte man sie bekommen? Ein Bursche sagte, dass einige Häuser von uns entfernt ein Arzt im Keller sei, wir liefen unter dem Pfeifen von Geschossen dorthin – da sah ich zum ersten Mal zerstörte Häuser.
Er sah sich meinen Arm an, verschrieb eine Behandlung mit Antibiotika zur intramuskulären Injektion. Das hieß, ich durfte nicht weiter stillen. Meine Schwester half aus – sie hatte auch einen Säugling und stillte beide. Wir machten uns in den Kellern auf die Suche nach Antibiotika – nichts. Doch da gab uns ein Mann die Adresse einer Frau, die nach einer Operation im Bett liegen musste und Antibiotika nahm. Die Eltern hatten Zigaretten und Alkohol aus ihrem Geschäft – sie bezahlten die Ärzte und kauften die notwendigen Medikamente.
Ich durfte nicht weiter stillen
Zwar konnten wir zunächst nur die halbe Menge Antibiotika beschaffen und auch kein Lidocain auftreiben, was die Injektion sehr schmerzhaft machte. Die Spritzen wurden zweimal täglich verabreicht, doch dann brachte ein junger Mann eine ganze Packung Ampullen. Schließlich gelang es irgendwie, die Wunde am Arm zu heilen.
Bei einigen Müttern versiegte die Milch. Viele kamen zu uns in den Keller und fragten nach Trockennahrung für Kinder und Säuglinge und nach Windeln. Manchmal tauchten irgendwelche seltsamen Leute auf und tauschten alles, was sie geraubt hatten, gegen Zigaretten und Alkohol.
Viele kamen ums Leben. Der sechsjährige Sohn meiner Bekannten wurde getötet, bei einer anderen Familie ein anderthalbjähriger Junge durch einen Splitter. In unserem Keller saß ein Junge mit gebrochenen Beinen – sie waren aus Sartana (seit März 2022 unter der Kontrolle der Volksrepublik Donezk; Anm. d. Red.) gekommen.
Bei einigen Müttern versiegte die Milch. Viele kamen zu uns in den Keller und fragten nach Trockennahrung für Kinder und Säuglinge und nach Windeln. Manchmal tauchten irgendwelche seltsamen Leute auf und tauschten alles, was sie geraubt hatten, gegen Zigaretten und Alkohol.
Viele kamen ums Leben. Der sechsjährige Sohn meiner Bekannten wurde getötet, bei einer anderen Familie ein anderthalbjähriger Junge durch einen Splitter. In unserem Keller saß ein Junge mit gebrochenen Beinen – sie waren aus Sartana (seit März 2022 unter der Kontrolle der Volksrepublik Donezk; Anm. d. Red.) gekommen.
Es gab Explosionen wie in Hollywood-Actionfilmen
Am meisten machte es Angst, wenn Stille eintrat – danach erfolgte oft sehr starker Beschuss. Wenn es ruhig wurde, führten die Leute ihre Kinder spazieren. Einmal war ein sonniger, nicht windiger Tag, alle nutzten das aus. Ein Nachbar kochte auf einer Feuerstelle und seine Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren spielten in der Nähe. Es gab eine starke Explosion, ihm wurde der Kopf abgerissen, die Kinder überlebten, aber eines verlor einen Arm und das andere ein Bein. Zu der Zeit war das Krankenhaus noch nicht zerbombt, sie wurden dorthin gebracht, was weiter mit ihnen geschah, weiß ich nicht.
Am schrecklichsten war, wenn Stille eintrat – danach erfolgte sehr starker Beschuss
Es gab Explosionen… wie in Hollywood-Actionfilmen. Manchmal war dichter Rauch von den Bränden, alles brannte. Einmal kam ein Flugzeug, bombardierte die Stadt, die Dreckskerle… und warf etwas Schreckliches über den drei Etagen hohen Häusern ab – die Erde flog zweimal so hoch wie diese Häuser waren. Als mein Vater unsere Großmutter besuchen ging, lief er durch diesen Bereich – er sagte, dort sei ein Krater von 8 mal 4 Metern.
Es gab kein Netz, nur Gerüchte. Die einzige Quelle für „offizielle“ Information war der Funkanschluss – es wurde ein und dasselbe gesagt, und diese Phrase wurde ständig wiederholt, ich gebe es ähnlich wieder: „Wir, die Befreier, sind gekommen, um euch zu beschützen und zu retten.“ Dann empfahlen sie den Soldaten der Ukrainischen Streitkräfte sich zu ergeben, das Magazin aus den Maschinenpistolen zu nehmen, das Gewehr über die linke Schulter zu hängen, eine weiße Fahne zu nehmen und in eine bestimmte Richtung zu gehen. „Ihr werdet am Leben bleiben, euch wird ermöglicht, euch mit euren Familien in Verbindung zu setzen und ihr werdet nach Beendigung der Kriegshandlungen nach Hause zurückkehren.“ Und danach kam ein Aufruf mit starkem südlichem Akzent, um einiges härter: „Ergebt euch! Wir sind in dieses Land gekommen, um die Feinde zu töten.“ Und diese Ansagen wechselten sich ab. Außerdem wurde von den Erfolgen der Russen an den Fronten berichtet, und bei uns, die wir im Keller saßen, entstand der Eindruck, dass bereits der Großteil der Ukraine erobert sei. Wenn du das monatelang hörst, kommt dir eine Evakuierung durch die Ukraine gar nicht in den Sinn. Wohin, wenn alles besetzt ist?
Meine Freunde hatten die Nummer 3000 in der Kontroll-Warteschlange, sie wollten absolut nicht nach Russland, aber man ließ sie nicht in die Ukraine gehen – sie sind jetzt auf dem Weg nach Irland.
Der einzige Weg für eine Evakuierung führte durch Russland
Wir fuhren am 24. März. Zu dieser Zeit war ein bedeutender Teil der Stadt bereits von den Russen eingenommen, weswegen der einzige Weg durch Russland führte. Wir hatten drei Autos, die alle heil geblieben waren – sogar die Fenster, das ist ein besonderer Luxus für Mariupol. Allerdings hat mein Bruder sein Auto stehen lassen. Wir sind selbst herausgekommen, obwohl die Entscheidung nicht leicht war – wir kannten Menschen, die weggefahren und verschwunden waren…
Die Stadt zu verlassen, ist überhaupt ein riesiges Problem. Denn Mariupol ist eine Stadt der Brücken. Um an die Stadtgrenze zu gelangen, mussten wir vier Brücken überqueren und alle waren zerstört. Da beschlossen die Männer einmal, Fluchtwege zu überprüfen und kamen zur ersten der beschädigten Brücken – daneben lag ein zerschossenes Auto. Aber dort war ein Bereich mit Einfamilienhäusern – die Leute haben die Metalltore abgenommen und sie wie eine Brücke verlegt. Es war gefährlich, aber man konnte langsam darüber fahren.
Am 23. kamen Nachbarn zu uns, sie stellten einen Konvoi zusammen, um rauszukommen und schlugen vor, uns ihnen anzuschließen.
An dem Tag, als wir abfuhren, gab es einen furchtbaren Beschuss – man hatte Angst, das Haus zu verlassen. Aber der Konvoi hatte sich schon aufgestellt, um 7 Uhr 30 machten wir uns auf den Weg. Um diese kleine Brücke herum lag eine große Menge kleiner Stifte – einen halben kleinen Finger groß, mit Federn – die Dartpfeilen ähnelten. Vielleicht eine Füllung für Bomben.
Unterwegs sah ich zerstörte Häuser, einige waren komplett schwarz, andere dagegen mit riesigen Löchern, gesprengte Panzer unter den Häusern. Viele Menschen gingen zu Fuß, eine lange Reihe. Wir nahmen so viele wie möglich mit.

Russische Bombardierung von Mariupol im März 2022
Foto mit freundlicher Genehmigung: Ministerium für Innere Angelegenheiten der Ukraine
Foto mit freundlicher Genehmigung: Ministerium für Innere Angelegenheiten der Ukraine
Ein Körper ohne Arme, Beine und Kopf lag da wie Abfall auf dem Weg herum. Da stand ein ausgeschlachtetes Auto – weiße Lappen, eine Aufschrift „Kinder“ und blutende Menschen
Buchstäblich eine Minute von dieser Brücke entfernt standen die Volksrepublik-Donezk-Leute auf einem Hügel, von dem aus man die gesamte Stadt überblicken konnte. Der Kontrollpunkt war aus verbrannten Autos und Reifen gebaut, damit die Leute sich hindurchschlängeln mussten. Da war eine riesige Menge Leichen. Natürlich hatte ich Tote auf dem Hof gesehen, aber hier lagen sie offensichtlich schon lange. Alle waren mit Staub bedeckt. Ein Körper ohne Arme, Beine und Kopf lag wie Abfall auf dem Weg herum. Da stand ein ausgeschlachtetes Auto – weiße Tücher, die Aufschrift „Kinder“ und blutüberströmte Menschen. Das war schrecklicher als alles, was ich bis dahin gesehen hatte. Dort stand eine Autoschlange und daneben schoss ein Panzer direkt auf die Stadt. Und ich sah, wo es explodierte.
Dachten sie wirklich, dass sie uns gerettet hätten?
Eine gründliche Durchsuchung konnte vermieden werden, indem man den Soldaten eine Flasche Alkohol und Zigaretten gab. In allen unseren Autos lag oben auf dem Gepäck diese Garnitur. Sie sprachen recht freundlich mit uns. Sie beruhigten uns sogar, hier sei es schon ruhig, es gebe keinen Beschuss. Natürlich nicht, dort gab es ja nichts mehr zu zerstören. Dachten sie wirklich, dass sie uns retteten? Sie prüften unsere Papiere, die Telefone, Papa öffnete den Kofferraum, der Soldat nahm das Paket und sagte, wir könnten weiterfahren. Bei meiner Schwester und meinem Bruder, die hinter uns fuhren, war es genauso. Unsere Sachen untersuchten sie nicht. Sie fragten, wo mein Mann sei – ich sagte: zu Hause. Ich zeigte nur meinen israelischen Pass, obwohl ich auch einen ukrainischen hatte. Das spielte keine Rolle.
Bei den anderen kontrollierten sie die Autos, einige Männer mussten sich ausziehen. Wir setzten unsere Fahrt fort – wieder gesprengte Autos, wieder herumliegende Leichen. Bis zum Verlassen der Stadt gab es vier solcher Kontrollposten. Bei jedem wurden die Papiere kontrolliert, sie fragten, wieso ich hier sei. Das Kind war damals 8 Monate alt, einige sprachen in Babysprache mit ihm… Tschetschenen habe ich in der Stadt nicht gesehen, ehrlich gesagt, es waren Russen, wenigstens in diesem Augenblick.
Bis zur russischen Grenze zählte ich mehr als 20 Kontrollposten. Die Strecke änderte sich, viele Brücken waren gesprengt worden. Viel Kriegstechnik – Panzer, Schützenpanzer. Einige repräsentative Autos waren sogar schwarz und ohne Nummern.
Ein Soldat am Kontrollpunkt warnte: das Feld als Toilette zu benutzen, sollte man vergessen – alles sei vermint, am Randstreifen dürfe man nicht anhalten. Als wir etwa 20 Kilometer von der Stadt entfernt waren, sahen wir, dass direkt im Feld ein BM-21 „Grad“-Rakenwerfer steht und Mariupol beschießt. Das war furchtbar.
Wir kamen zu einem Städtchen in der Volksrepublik Donezk, wo man eine Kontrolle passieren sollte. Bis heute habe ich den Zettel verwahrt (siehe Foto), der mir erlaubte, die russische Grenze zu überqueren.
Bei der Polizei wurde uns gesagt, wir sollten eine Fotokopie der Dokumente mitbringen, aber wir hatten nur Griwna (ukrainische Währung) und man konnte nirgends Geld wechseln. Ich fühlte mich so hilflos. Ich wollte im Geschäft Feuchttücher kaufen – um das Kind abzuwischen, Einmallöffel, um es zu füttern. Aber ich hatte keine Rubel und die Stadt war voller Flüchtlinge wie wir.
Das Leben in der Volksrepublik Donezk war einfach stehengeblieben
Die Volksrepublik Donezk ist etwas Schreckliches, das Leben ist dort einfach stehengeblieben. Es gibt kein Internet, man kann nirgends übernachten, es wird dunkel. An der Polizeistation ist eine riesige Schlange. Mama lief von einem Ort zum anderen und bot Schokolade für eine Fotokopie an – aber niemand ging darauf ein. Papa fand einen Mann, der bereit war, 100 Dollar in Rubel zu wechseln… Wir machten die Kopie, erhielten Formulare – jetzt mussten wir uns registrieren lassen. Welches Auto, wer fährt mit ihm, wie viele Leute, wo waren sie vorher gewesen, hatten sie den Ukrainischen Streitkräften geholfen, standen sie in Kontakt mit dem ukrainischen Militär usw. Wir stehen 4 Stunden in der Schlange, es beginnt dunkel zu werden… Meine Mutter ist kämpferisch, sie ging zum Chef: „Nehmen Sie uns dran, im Auto sitzen 3 Kinder.“ Mein Bruder hat eine Tochter von 9 Jahren, meine Schwester einen Jungen von einem Jahr und 10 Monaten und ich ein Baby von 8 Monaten. Dieser Chef sah meine Mutter an und meinte: „Fahren Sie langsam los, man wird Sie durchlassen.“
Wir fuhren weiter durch Nikolskoje, Dokutschaewsk, Dobropolje, Amwrosijewska. Nach einigen Stunden kamen wir zur russischen Grenze. Dort steht ein Häuschen, von dem aus der Grenzsoldat warnt, dass man ohne Registrierung nicht passieren kann. Kehren Sie um, heißt es, hier ist eine Ortschaft, melden Sie sich bei der Polizeidienststelle an. Was tun, wir fuhren los – dort war kein Mensch, man empfing uns, Sie werden es nicht glauben, wie Familie. Sie behandelten uns so verständnisvoll, führten uns in die Versammlungshalle. Dort standen Betten, es gab Tee, Kaffee, Gebäck. Sie zeigten uns, wo wir uns waschen konnten. Einige interessierten sich für die Zustände in konkreten Stadtteilen Mariupols – sie hatten dort Angehörige, Schwestern und Brüder. Sie weinten, wir weinten (sie weint). Sie teilten jedem einen Mitarbeiter zu, führten uns zu den Büros, aber dennoch ließen sie die Männer sich auskleiden, prüften die Tätowierungen, fotografierten die Gesichter von vorne und im Profil und nahmen Fingerabdrücke. Sie scannten alle Pässe und überprüften alle Telefone.
Im Grunde war es ein Verhör: wann ich angekommen war, wo meine Eltern wohnen, wo sie gemeldet sind, ihr Geburtsdatum, ihre Telefonnummern. Dasselbe für jedes Familienmitglied. Wo du wohnst, und wie du eingestellt bist – und alles wurde notiert.
Als sie den israelischen Pass sahen, riefen sie das russische Katastrophenschutzministerium an und teilten mit, wo ich mich befand. Und von dort kontaktierte man die Botschaft.
Wir wussten noch nicht, wo Papas Schwester sich mit ihrer Familie aufhielt, ob sie am Leben waren. Doch bei der Kontrolle der Pässe sagte ein Mitarbeiter: „Der Familienname kommt mir bekannt vor. Ich habe ihn gestern irgendwo gesehen.“ Er blättert in einem Büchlein und tatsächlich – da sind alle Verwandten von Papa, sie sind gestern ausgereist.
Niemals habe ich von jemandem gehört, dass er nach Russland will. Nicht ein einziges Mal
Endlich erhielten wir diese Papiere mit Stempel und Unterschrift. Und mit ihnen bewegten wir uns in Richtung russische Grenze. Es war etwa 9 Uhr abends. Als wir an der Reihe waren, bogen wir ab – wie alle Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen. Etwa 2 Stunden saßen wir einfach so da, dann nahmen sie die Papiere und gaben sie lange nicht zurück, dann gingen sie zu allen ukrainischen Autos und holten die Männer – in unserem Fall Papa und meinen Bruder. Sie nahmen sie für ein bis zwei Stunden mit – das gleiche Verhör – sie mussten sich ausziehen, man nahm Fingerabdrücke usw.
Dann kontrollierten sie das Auto – etwa eine Stunde, und dann standen wir noch ein paar Stunden. Insgesamt dauerte es sieben Stunden, um ein Uhr nachts ließen sie uns fahren. Wir wollten ein Hotel nehmen, aber alles war übervoll und so mussten wir nachts nach Rostow fahren. Dort übernachteten wir und brachten uns in Ordnung. Wir wechselten die Dollars – ich erinnere mich nicht mehr an den Kurs, aber wenn es in Griwna fast 2000 Dollar waren, dann bekamen wir in Rubel den Gegenwert von 700 Dollar.
Das Ziel war Georgien, niemand wollte in der russischen Föderation bleiben, das hatten wir bereits im Keller beschlossen. Viermal übernachteten wir in Hotels – an der Rezeption wussten alle Bescheid, wir waren ja nicht die einzigen, die auf diesem Weg geflohen sind. Die Stadt war zerstört, es gab sie nicht mehr. Den Flüchtlingen war anzusehen, dass sie sich einen Monat lang nicht gewaschen hatten. Alles roch nach Feuer und Ruß. Alle verstanden die Situation, viele weinten, einige entschuldigten sich. Ein Cousin meiner Mama lebt in Moskau – auch er rief an und entschuldigte sich.
Dachten sie wirklich, dass sie uns gerettet hätten?
Eine gründliche Durchsuchung konnte vermieden werden, indem man den Soldaten eine Flasche Alkohol und Zigaretten gab. In allen unseren Autos lag oben auf dem Gepäck diese Garnitur. Sie sprachen recht freundlich mit uns. Sie beruhigten uns sogar, hier sei es schon ruhig, es gebe keinen Beschuss. Natürlich nicht, dort gab es ja nichts mehr zu zerstören. Dachten sie wirklich, dass sie uns retteten? Sie prüften unsere Papiere, die Telefone, Papa öffnete den Kofferraum, der Soldat nahm das Paket und sagte, wir könnten weiterfahren. Bei meiner Schwester und meinem Bruder, die hinter uns fuhren, war es genauso. Unsere Sachen untersuchten sie nicht. Sie fragten, wo mein Mann sei – ich sagte: zu Hause. Ich zeigte nur meinen israelischen Pass, obwohl ich auch einen ukrainischen hatte. Das spielte keine Rolle.
Bei den anderen kontrollierten sie die Autos, einige Männer mussten sich ausziehen. Wir setzten unsere Fahrt fort – wieder gesprengte Autos, wieder herumliegende Leichen. Bis zum Verlassen der Stadt gab es vier solcher Kontrollposten. Bei jedem wurden die Papiere kontrolliert, sie fragten, wieso ich hier sei. Das Kind war damals 8 Monate alt, einige sprachen in Babysprache mit ihm… Tschetschenen habe ich in der Stadt nicht gesehen, ehrlich gesagt, es waren Russen, wenigstens in diesem Augenblick.
Bis zur russischen Grenze zählte ich mehr als 20 Kontrollposten. Die Strecke änderte sich, viele Brücken waren gesprengt worden. Viel Kriegstechnik – Panzer, Schützenpanzer. Einige repräsentative Autos waren sogar schwarz und ohne Nummern.
Ein Soldat am Kontrollpunkt warnte: das Feld als Toilette zu benutzen, sollte man vergessen – alles sei vermint, am Randstreifen dürfe man nicht anhalten. Als wir etwa 20 Kilometer von der Stadt entfernt waren, sahen wir, dass direkt im Feld ein BM-21 „Grad“-Rakenwerfer steht und Mariupol beschießt. Das war furchtbar.
Wir kamen zu einem Städtchen in der Volksrepublik Donezk, wo man eine Kontrolle passieren sollte. Bis heute habe ich den Zettel verwahrt (siehe Foto), der mir erlaubte, die russische Grenze zu überqueren.
Bei der Polizei wurde uns gesagt, wir sollten eine Fotokopie der Dokumente mitbringen, aber wir hatten nur Griwna (ukrainische Währung) und man konnte nirgends Geld wechseln. Ich fühlte mich so hilflos. Ich wollte im Geschäft Feuchttücher kaufen – um das Kind abzuwischen, Einmallöffel, um es zu füttern. Aber ich hatte keine Rubel und die Stadt war voller Flüchtlinge wie wir.
Das Leben in der Volksrepublik Donezk war einfach stehengeblieben
Die Volksrepublik Donezk ist etwas Schreckliches, das Leben ist dort einfach stehengeblieben. Es gibt kein Internet, man kann nirgends übernachten, es wird dunkel. An der Polizeistation ist eine riesige Schlange. Mama lief von einem Ort zum anderen und bot Schokolade für eine Fotokopie an – aber niemand ging darauf ein. Papa fand einen Mann, der bereit war, 100 Dollar in Rubel zu wechseln… Wir machten die Kopie, erhielten Formulare – jetzt mussten wir uns registrieren lassen. Welches Auto, wer fährt mit ihm, wie viele Leute, wo waren sie vorher gewesen, hatten sie den Ukrainischen Streitkräften geholfen, standen sie in Kontakt mit dem ukrainischen Militär usw. Wir stehen 4 Stunden in der Schlange, es beginnt dunkel zu werden… Meine Mutter ist kämpferisch, sie ging zum Chef: „Nehmen Sie uns dran, im Auto sitzen 3 Kinder.“ Mein Bruder hat eine Tochter von 9 Jahren, meine Schwester einen Jungen von einem Jahr und 10 Monaten und ich ein Baby von 8 Monaten. Dieser Chef sah meine Mutter an und meinte: „Fahren Sie langsam los, man wird Sie durchlassen.“
Wir fuhren weiter durch Nikolskoje, Dokutschaewsk, Dobropolje, Amwrosijewska. Nach einigen Stunden kamen wir zur russischen Grenze. Dort steht ein Häuschen, von dem aus der Grenzsoldat warnt, dass man ohne Registrierung nicht passieren kann. Kehren Sie um, heißt es, hier ist eine Ortschaft, melden Sie sich bei der Polizeidienststelle an. Was tun, wir fuhren los – dort war kein Mensch, man empfing uns, Sie werden es nicht glauben, wie Familie. Sie behandelten uns so verständnisvoll, führten uns in die Versammlungshalle. Dort standen Betten, es gab Tee, Kaffee, Gebäck. Sie zeigten uns, wo wir uns waschen konnten. Einige interessierten sich für die Zustände in konkreten Stadtteilen Mariupols – sie hatten dort Angehörige, Schwestern und Brüder. Sie weinten, wir weinten (sie weint). Sie teilten jedem einen Mitarbeiter zu, führten uns zu den Büros, aber dennoch ließen sie die Männer sich auskleiden, prüften die Tätowierungen, fotografierten die Gesichter von vorne und im Profil und nahmen Fingerabdrücke. Sie scannten alle Pässe und überprüften alle Telefone.
Im Grunde war es ein Verhör: wann ich angekommen war, wo meine Eltern wohnen, wo sie gemeldet sind, ihr Geburtsdatum, ihre Telefonnummern. Dasselbe für jedes Familienmitglied. Wo du wohnst, und wie du eingestellt bist – und alles wurde notiert.
Als sie den israelischen Pass sahen, riefen sie das russische Katastrophenschutzministerium an und teilten mit, wo ich mich befand. Und von dort kontaktierte man die Botschaft.
Wir wussten noch nicht, wo Papas Schwester sich mit ihrer Familie aufhielt, ob sie am Leben waren. Doch bei der Kontrolle der Pässe sagte ein Mitarbeiter: „Der Familienname kommt mir bekannt vor. Ich habe ihn gestern irgendwo gesehen.“ Er blättert in einem Büchlein und tatsächlich – da sind alle Verwandten von Papa, sie sind gestern ausgereist.
Niemals habe ich von jemandem gehört, dass er nach Russland will. Nicht ein einziges Mal
Endlich erhielten wir diese Papiere mit Stempel und Unterschrift. Und mit ihnen bewegten wir uns in Richtung russische Grenze. Es war etwa 9 Uhr abends. Als wir an der Reihe waren, bogen wir ab – wie alle Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen. Etwa 2 Stunden saßen wir einfach so da, dann nahmen sie die Papiere und gaben sie lange nicht zurück, dann gingen sie zu allen ukrainischen Autos und holten die Männer – in unserem Fall Papa und meinen Bruder. Sie nahmen sie für ein bis zwei Stunden mit – das gleiche Verhör – sie mussten sich ausziehen, man nahm Fingerabdrücke usw.
Dann kontrollierten sie das Auto – etwa eine Stunde, und dann standen wir noch ein paar Stunden. Insgesamt dauerte es sieben Stunden, um ein Uhr nachts ließen sie uns fahren. Wir wollten ein Hotel nehmen, aber alles war übervoll und so mussten wir nachts nach Rostow fahren. Dort übernachteten wir und brachten uns in Ordnung. Wir wechselten die Dollars – ich erinnere mich nicht mehr an den Kurs, aber wenn es in Griwna fast 2000 Dollar waren, dann bekamen wir in Rubel den Gegenwert von 700 Dollar.
Das Ziel war Georgien, niemand wollte in der russischen Föderation bleiben, das hatten wir bereits im Keller beschlossen. Viermal übernachteten wir in Hotels – an der Rezeption wussten alle Bescheid, wir waren ja nicht die einzigen, die auf diesem Weg geflohen sind. Die Stadt war zerstört, es gab sie nicht mehr. Den Flüchtlingen war anzusehen, dass sie sich einen Monat lang nicht gewaschen hatten. Alles roch nach Feuer und Ruß. Alle verstanden die Situation, viele weinten, einige entschuldigten sich. Ein Cousin meiner Mama lebt in Moskau – auch er rief an und entschuldigte sich.

Folgen des Beschusses des Kinderkrankenhauses und der Geburtsklinik in Mariupol
Foto mit freundlicher Genehmigung: Army Inform
Foto mit freundlicher Genehmigung: Army Inform
Die Stadt war zerstört, es gab sie nicht mehr. Den Flüchtlingen war anzusehen, dass sie sich einen Monat lang nicht gewaschen hatten. Alles roch nach Feuer und Ruß
Ich war in Mariupol aufgewachsen, hatte dort die Schule und die Hochschule absolviert und kehrte regelmäßig zu meiner Familie zurück. Ich emigrierte mit 22. Niemals und von niemandem habe ich gehört, dass sie nach Russland wollten. Nicht ein einziges Mal. Besonders nach 2014, als Mariupol bombardiert wurde. Und wie viele Flüchtlinge aus Donezk gab es damals! Wer wollte schon nach Russland?! In Mariupol wusste man zu gut, was die Volksrepublik Donezk und die Volksrepublik Lugansk waren und wer dahintersteckte. Bei diesem Besuch war ich von der Stadt überwältigt – sauber, schön, modern – man wollte hier wohnen, arbeiten, es gab Möglichkeiten zum Ausgehen. Das war alles in der Vergangenheit.
In Nordossetien machten wir Halt, da begannen sich die Leute am Kontrollpunkt zu nähern, schlugen uns vor, uns umzuziehen, boten Essen und Wasser an. Es gab nur einen Zwischenfall, ein Polizist hielt das Auto an, in dem mein Bruder und meine Schwester saßen, wollte offensichtlich Schmiergeld haben. Nach allem, was wir durchgemacht haben, war das einfach lächerlich. Katjas Kind war müde, auf dem Autositz zu sitzen, sie hatten es auf den Schoß genommen. Na, dann müssen sie eben ein Bußgeld zahlen. Aber mein Bruder war gereizt – er hatte sein gut laufendes Unternehmen in Mariupol zurückgelassen, und jetzt hat er weder eine Wohnung noch Arbeit und fährt irgendwohin im Auto seiner Schwester, ganz aufgeschmissen… Und jetzt verpassen sie ihm auch noch Strafgeld. „Na, schreib schon“, sagt er. „Man hat mir sowieso schon alles genommen, schreib.“ Der Polizist zögert, er will Geld „Was sagst du da, gibst du uns die Schuld für alles?“ fragt er. Dann gab er ihm schweigend die Papiere zurück und ließ uns fahren.
An der Grenze versuchten sie, uns den ukrainischen Pass abzulisten
An der russisch-georgischen Grenze verbrachten wir fünf Stunden – wieder wurden die Männer vernommen, beiseite geführt, und wieder dasselbe: wo sie geboren waren, was sie arbeiteten, wieder mussten sie sich ausziehen, wieder Fingerabdrücke und Kontrolle der Telefone.
Ich zeigte überall ausschließlich meinen israelischen Pass, aber hier nahm der Grenzbeamte ihn an sich.
„Wie sind Sie auf russisches Territorium gekommen?“
„Was meinen Sie? Ich habe die Grenze offiziell überquert.“
„Aber Sie haben nicht diesen Pass, sondern einen ukrainischen gezeigt.“
„Kontrollieren Sie“, sage ich, „ich habe keine anderen Pässe gezeigt“. Auch das Papier über die Grenzüberquerung hatte die Nummer des israelischen Passes. Ich zeigte es vor.
„Es wurde nicht gestempelt.“
„Dann muss ich also Ihren Grenzdienst kontrollieren?“
Da kommt Mama und fragt, was los ist. „Ich brauche ihren ukrainischen Pass, man hat ihn ihr nicht gestempelt“, sagt der Grenzbeamte. Mama nahm all unsere Pässe – sie waren auch nicht gestempelt. „Es geht nicht um den Stempel, sondern um den Pass“, sagt er, „sie hat diesen Pass nicht an der Grenze vorgelegt“. Einfach lächerlich.
Ich wurde in ein Zimmer geführt, den Pass gaben sie mir nicht zurück. „Warten Sie“, sagen sie, „und nehmen Sie Ihr Handy mit.“ Binnen 20 Minuten kommen zwei Mitarbeiter zu mir: „Und wo ist Ihr ukrainischer Pass?“
„Was für ein Pass, ich sage Ihnen doch, dass ich nur einen israelischen Pass habe.“
„Aber Sie haben doch einen ukrainischen Pass?“
„Nein.“
Der zweite tritt heran: „Aber Sie haben den ukrainischen Pass vorgezeigt, ja?“
„Ich habe den israelischen gezeigt, haben Sie ihn verloren?“
„Nein-nein.“
Er ging. Da sehe ich, wie meine Mutter mit der Kleinen kommt. Sie ging zum Wachbeamten: „Lassen Sie mich herein“, sagt sie, „es ist Zeit, meine Enkelin zu stillen.“ Sie ließen sie rein, mich führten sie mit dem Kind in ein anderes Zimmer. Ich durfte der Kleinen die Brust geben. Und da fing meine Tochter an zu weinen, sie wollte schlafen und das beschleunigte die Sache etwas. Innerhalb von 15 Minuten kamen erneut zwei Mitarbeiter und fragten nach dem ukrainischen Pass. Dann gingen wir hoch in ein Büro – dort sitzt ein ernster Typ und wieder dieselben Fragen, wer wo wohnt, wo sie sich aufhielten, Anmeldebescheinigung, Daten der Angehörigen, Telefonnummern. Und wieder ein Dutzend Fragen zu dem ukrainischen Pass, nun, wo ist er denn, warum ist er nicht da, wo er geblieben ist, er ist unbedingt notwendig. „Sie verstehen, es gibt sehr viele gefälschte israelische Papiere.“
„Wissen Sie“, sage ich, „ich kann Ihnen meinen israelischen Inlandspass zeigen, die israelische Geburtsurkunde meiner Tochter, meine Heiratsurkunde usw.“ Wenn es darum geht. Sie wollten sie nicht einmal sehen. Und zum Schluss fragt er: „Wo waren Sie während der militärischen Rettungsaktion?“ Für diese Frage hätte ich ihm am liebsten eine reingehauen! Er fragte sogar, wie wir unsere Notdurft verrichtet haben. Ich hatte da keine Hemmungen – naturgetreu beschrieb ich ihm Eimer, Beutel usw. Er hat das alles aufgeschrieben. Dann lehnt er sich in seinem Sessel zurück und fragt: „Und an was glauben Sie, an Gott z. B.?“ „Nein“, antworte ich. Als ob ich mit ihm noch über Gott sprechen würde.
„Und an irgendwelche Geister?“
Ich lüge nicht, ich weiß nicht, warum er das fragt…
„Und an irgendeinen Stein?“
„Ist das Ihr Ernst?“
„Ja, ich meine es ernst, manche glauben an prophetische Träume.“
Damit war das Verhör beendet. Mein Akku war leer, nachdem mein Handy auf seinem Schreibtisch gelegen hatte. Wir nahmen unsere Papiere. Als wir Anstalten machten zu gehen, entschuldigte er sich: „Sie müssen verstehen, das ist unsere Arbeit.“ Dann standen wir noch anderthalb Stunden, warteten, bis sie meinem Bruder seine Papiere zurückgaben.
In Georgien waren wir willkommen wie zu Hause
Der Zoll in Georgien war in 10 Minuten erledigt. Das Erste, was ich dort sah, war die ukrainische Flagge. Ich liebe dieses Land sehr, und jetzt empfingen sie uns tatsächlich wie zu Hause. Ich habe in der Ukraine nicht so viele gelb-blaue Flaggen gesehen – auf drei Häusern zählte ich zehn Stück. Überall spielte ukrainische Musik, überall stand „Ruhm der Ukraine!“. In einigen Geschäften gab man Ukrainern gratis Brot. Mein Mann schickte uns Geld, aber von uns nahmen sie nichts für die Unterbringung, sie weigerten sich strikt. Die Wirtin sagte, dass sei ihre Hilfe für die Ukraine. Sie gab uns ein separates Häuschen und Essen…
In Nordossetien machten wir Halt, da begannen sich die Leute am Kontrollpunkt zu nähern, schlugen uns vor, uns umzuziehen, boten Essen und Wasser an. Es gab nur einen Zwischenfall, ein Polizist hielt das Auto an, in dem mein Bruder und meine Schwester saßen, wollte offensichtlich Schmiergeld haben. Nach allem, was wir durchgemacht haben, war das einfach lächerlich. Katjas Kind war müde, auf dem Autositz zu sitzen, sie hatten es auf den Schoß genommen. Na, dann müssen sie eben ein Bußgeld zahlen. Aber mein Bruder war gereizt – er hatte sein gut laufendes Unternehmen in Mariupol zurückgelassen, und jetzt hat er weder eine Wohnung noch Arbeit und fährt irgendwohin im Auto seiner Schwester, ganz aufgeschmissen… Und jetzt verpassen sie ihm auch noch Strafgeld. „Na, schreib schon“, sagt er. „Man hat mir sowieso schon alles genommen, schreib.“ Der Polizist zögert, er will Geld „Was sagst du da, gibst du uns die Schuld für alles?“ fragt er. Dann gab er ihm schweigend die Papiere zurück und ließ uns fahren.
An der Grenze versuchten sie, uns den ukrainischen Pass abzulisten
An der russisch-georgischen Grenze verbrachten wir fünf Stunden – wieder wurden die Männer vernommen, beiseite geführt, und wieder dasselbe: wo sie geboren waren, was sie arbeiteten, wieder mussten sie sich ausziehen, wieder Fingerabdrücke und Kontrolle der Telefone.
Ich zeigte überall ausschließlich meinen israelischen Pass, aber hier nahm der Grenzbeamte ihn an sich.
„Wie sind Sie auf russisches Territorium gekommen?“
„Was meinen Sie? Ich habe die Grenze offiziell überquert.“
„Aber Sie haben nicht diesen Pass, sondern einen ukrainischen gezeigt.“
„Kontrollieren Sie“, sage ich, „ich habe keine anderen Pässe gezeigt“. Auch das Papier über die Grenzüberquerung hatte die Nummer des israelischen Passes. Ich zeigte es vor.
„Es wurde nicht gestempelt.“
„Dann muss ich also Ihren Grenzdienst kontrollieren?“
Da kommt Mama und fragt, was los ist. „Ich brauche ihren ukrainischen Pass, man hat ihn ihr nicht gestempelt“, sagt der Grenzbeamte. Mama nahm all unsere Pässe – sie waren auch nicht gestempelt. „Es geht nicht um den Stempel, sondern um den Pass“, sagt er, „sie hat diesen Pass nicht an der Grenze vorgelegt“. Einfach lächerlich.
Ich wurde in ein Zimmer geführt, den Pass gaben sie mir nicht zurück. „Warten Sie“, sagen sie, „und nehmen Sie Ihr Handy mit.“ Binnen 20 Minuten kommen zwei Mitarbeiter zu mir: „Und wo ist Ihr ukrainischer Pass?“
„Was für ein Pass, ich sage Ihnen doch, dass ich nur einen israelischen Pass habe.“
„Aber Sie haben doch einen ukrainischen Pass?“
„Nein.“
Der zweite tritt heran: „Aber Sie haben den ukrainischen Pass vorgezeigt, ja?“
„Ich habe den israelischen gezeigt, haben Sie ihn verloren?“
„Nein-nein.“
Er ging. Da sehe ich, wie meine Mutter mit der Kleinen kommt. Sie ging zum Wachbeamten: „Lassen Sie mich herein“, sagt sie, „es ist Zeit, meine Enkelin zu stillen.“ Sie ließen sie rein, mich führten sie mit dem Kind in ein anderes Zimmer. Ich durfte der Kleinen die Brust geben. Und da fing meine Tochter an zu weinen, sie wollte schlafen und das beschleunigte die Sache etwas. Innerhalb von 15 Minuten kamen erneut zwei Mitarbeiter und fragten nach dem ukrainischen Pass. Dann gingen wir hoch in ein Büro – dort sitzt ein ernster Typ und wieder dieselben Fragen, wer wo wohnt, wo sie sich aufhielten, Anmeldebescheinigung, Daten der Angehörigen, Telefonnummern. Und wieder ein Dutzend Fragen zu dem ukrainischen Pass, nun, wo ist er denn, warum ist er nicht da, wo er geblieben ist, er ist unbedingt notwendig. „Sie verstehen, es gibt sehr viele gefälschte israelische Papiere.“
„Wissen Sie“, sage ich, „ich kann Ihnen meinen israelischen Inlandspass zeigen, die israelische Geburtsurkunde meiner Tochter, meine Heiratsurkunde usw.“ Wenn es darum geht. Sie wollten sie nicht einmal sehen. Und zum Schluss fragt er: „Wo waren Sie während der militärischen Rettungsaktion?“ Für diese Frage hätte ich ihm am liebsten eine reingehauen! Er fragte sogar, wie wir unsere Notdurft verrichtet haben. Ich hatte da keine Hemmungen – naturgetreu beschrieb ich ihm Eimer, Beutel usw. Er hat das alles aufgeschrieben. Dann lehnt er sich in seinem Sessel zurück und fragt: „Und an was glauben Sie, an Gott z. B.?“ „Nein“, antworte ich. Als ob ich mit ihm noch über Gott sprechen würde.
„Und an irgendwelche Geister?“
Ich lüge nicht, ich weiß nicht, warum er das fragt…
„Und an irgendeinen Stein?“
„Ist das Ihr Ernst?“
„Ja, ich meine es ernst, manche glauben an prophetische Träume.“
Damit war das Verhör beendet. Mein Akku war leer, nachdem mein Handy auf seinem Schreibtisch gelegen hatte. Wir nahmen unsere Papiere. Als wir Anstalten machten zu gehen, entschuldigte er sich: „Sie müssen verstehen, das ist unsere Arbeit.“ Dann standen wir noch anderthalb Stunden, warteten, bis sie meinem Bruder seine Papiere zurückgaben.
In Georgien waren wir willkommen wie zu Hause
Der Zoll in Georgien war in 10 Minuten erledigt. Das Erste, was ich dort sah, war die ukrainische Flagge. Ich liebe dieses Land sehr, und jetzt empfingen sie uns tatsächlich wie zu Hause. Ich habe in der Ukraine nicht so viele gelb-blaue Flaggen gesehen – auf drei Häusern zählte ich zehn Stück. Überall spielte ukrainische Musik, überall stand „Ruhm der Ukraine!“. In einigen Geschäften gab man Ukrainern gratis Brot. Mein Mann schickte uns Geld, aber von uns nahmen sie nichts für die Unterbringung, sie weigerten sich strikt. Die Wirtin sagte, dass sei ihre Hilfe für die Ukraine. Sie gab uns ein separates Häuschen und Essen…
Es stellte sich heraus, dass den neuen Machthabern schon eine entsprechende Liste vorlag und unsere Großmutter darin auf der Nummer 20 000 stand
Mein Bruder fand eine Wohnung für sich. Als sie erfuhren, dass er aus der Ukraine kam, nahmen sie keinen Cent von ihm und kamen abends, um die ganze Familie zu unterhalten. Meiner Schwester brach ein Zahn ab, sie ging zum Zahnarzt. Als man erfuhr, woher sie kam, nahmen sie kein Geld an.
In Georgien blieben wir eine Woche. Mein Mann kam mit dem Flugzeug, um uns abzuholen, und nahm mich und unsere Tochter mit nach Israel.
Meine Eltern bleiben noch in Georgien. Mein Bruder brachte seine Familie nach Italien, er selbst kehrte nach Mariupol zurück. Er hatte dort zwei Druckereien, eine hatten sie in die Luft gejagt, die zweite war heil geblieben – darin waren sehr teure Maschinen. Diese in die Ukraine zu bringen ist unmöglich. Er sagt, Geld brauche er nicht, es gibt nichts, für das man es ausgeben könnte. Ich schreibe ihm: „Kirill, in Russland herrscht Papiermangel, denk dran.“ Er antwortet mir: „Denk daran, was du schreibst.“ Alle passen jetzt dort sehr auf, was sie sagen.
Es dauerte mehrere Wochen, bis wir die Umbettung unserer Großmutter vereinbaren konnten. Es stellte sich heraus, dass die neuen Machthaber schon eine entsprechende Liste erstellt hatten und unsere Großmutter darin an 20.000. Stelle stand. Das Problem wurde für 600 Dollar gelöst. Sie wurde exhumiert und auf dem Friedhof neben ihrem Mann beigesetzt.
Bekannte berichten, dass im Lager „Metro“ ein Berg Leichen liege und Leute dort nach ihren vermissten Angehörigen suchen. Es riecht sehr stark, da die Leichen sich zersetzen…
In Georgien blieben wir eine Woche. Mein Mann kam mit dem Flugzeug, um uns abzuholen, und nahm mich und unsere Tochter mit nach Israel.
Meine Eltern bleiben noch in Georgien. Mein Bruder brachte seine Familie nach Italien, er selbst kehrte nach Mariupol zurück. Er hatte dort zwei Druckereien, eine hatten sie in die Luft gejagt, die zweite war heil geblieben – darin waren sehr teure Maschinen. Diese in die Ukraine zu bringen ist unmöglich. Er sagt, Geld brauche er nicht, es gibt nichts, für das man es ausgeben könnte. Ich schreibe ihm: „Kirill, in Russland herrscht Papiermangel, denk dran.“ Er antwortet mir: „Denk daran, was du schreibst.“ Alle passen jetzt dort sehr auf, was sie sagen.
Es dauerte mehrere Wochen, bis wir die Umbettung unserer Großmutter vereinbaren konnten. Es stellte sich heraus, dass die neuen Machthaber schon eine entsprechende Liste erstellt hatten und unsere Großmutter darin an 20.000. Stelle stand. Das Problem wurde für 600 Dollar gelöst. Sie wurde exhumiert und auf dem Friedhof neben ihrem Mann beigesetzt.
Bekannte berichten, dass im Lager „Metro“ ein Berg Leichen liege und Leute dort nach ihren vermissten Angehörigen suchen. Es riecht sehr stark, da die Leichen sich zersetzen…
Die Zeugenaussage wurde am 24. Mai 2022 aufgezeichnet
Übersetzung: Dr. Dorothea Kollenbach
Übersetzung: Dr. Dorothea Kollenbach